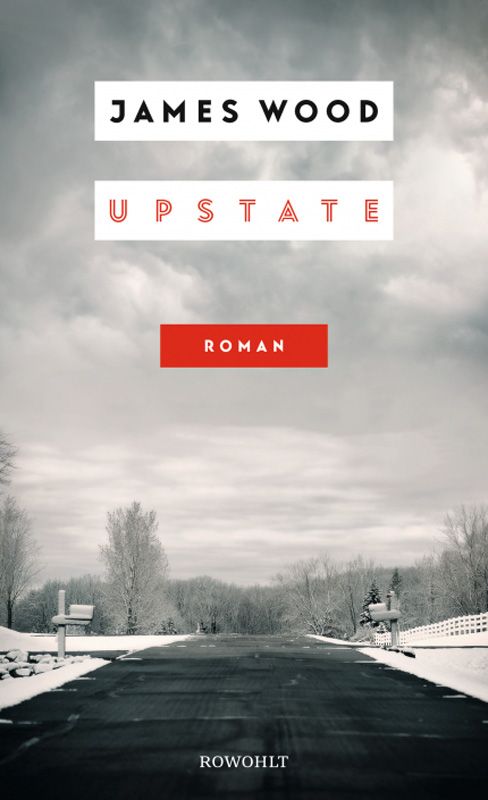
James Wood, "Upstate". Übersetzt von Tanja Handels. 22,– Euro / 304 Seiten. Rowohlt-Verlag, 2019
James Wood ist ein Essayist, Journalist und Literaturkritiker, seit 2010 lehrt er an der Harvard University. Davor war er Kritiker beim Guardian und Juror für den renommierten Booker Prize. Er schreibt regelmäßig für den New Yorker.
2008 veröffentlichte er How Fiction Works, auf Deutsch erschienen unter dem poetischeren Titel Die Kunst des Erzählens. Jetzt hat er selbst seinen zweiten Roman vorgelegt. Was liegt also näher, als ihn an seinem eigenen Leitfaden zu messen?
Wood ist undogmatisch, humorvoll – und er ist Brite. Der Protagonist seines Romans Upstate ist ebenfalls Brite, ein Mann fortgeschrittenen Alters, der in Immobilien macht und es, aus kleinen Verhältnissen kommend, zu beträchtlichem Wohlstand gebracht hat.
Schon die Einstiegsszene, in der der Mann seine Mutter im Altersheim besucht, löst alle Forderungen ein, die Wood an das gelungene Detail stellt: "Er durchquerte zwei schnaufende Feuerschutztüren, die den schalen Hefedunst eines Wochenendes konservierten."
Hier sind wir sofort mit allen Sinnen dabei, ob wir wollen oder nicht. Mit liebevoller Direktheit beschreibt er die aufgesetzt noble Diktion der alten Dame, die eigentlich aus einem Arbeitervorort von Edinburgh stammt.
Das kann er: mit wenigen Strichen eine Szene zeichnen, in zwei, drei Absätzen ein ganzes Leben aufblättern, auf sechseinhalb Seiten nicht nur das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn darlegen, sondern auch gleich in medias res springen: Eigentlich geht es um Vanessa, die erwachsene Tochter des Mannes, die im titelgebenden Upstate New York Philosophie lehrt.
Sie ist unglücklich, ja, die Familie fürchtet sogar, sie habe versucht, sich etwas anzutun. Erst in Kapitel zwölf, also bei fast einem Drittel des Buches, wird sie ihren ersten Auftritt haben.
Macht Geld glücklich?
Vorerst bleibt der Autor mit uns bei dem sorgenvollen Vater und einem personalen Erzählstil, der uns viel über das Innenleben des Mannes verrät. Aber auch im Außen spiegelt sich stets das Innen, keine Beschreibung passiert hier bloß um ihrer selbst willen: "Das Haus der Querrys wirkte durchaus ansehnlich – als wäre es auf Fels gebaut und nicht auf Sand. Er kurviger Kiesweg (…), massive Mauern, hohe Fenster, ein schwarzes S aus Metall, das wegsackendes Mauerwerk stützen sollte, eine robuste alte Haustür, ein verbogener, schwarzer Stiefelkratzer aus Eisen, wie man ihn niemals kaufen, sondern nur erben konnte. (…) Das Haus sah aus wie das eines Menschen, der etwas aus sich gemacht hatte."
In diesem Haus hat der Protagonist seine beiden Töchter großgezogen, nachdem ihn seine Frau verlassen hatte. Nur eine aber, Helen, ist glücklich. Warum die beiden Schwestern, ähnlich alt und gemeinsam sozialisiert, so verschieden sind, um diese Frage kreist das Buch.
Trotz des nicht eben fröhlichen Settings schafft es Wood, die Leserin immer wieder zum Lachen zu bringen und das vornehmlich mit der Liebe zum bissigen Detail: zum Beispiel mit "rostfarbenen Cordhosen, die leuchten wie die Glut alten Geldes".
Denn immer schwingt bei Wood über das Familiäre hinaus das allgemein Gültige, das Soziologische mit: Macht Geld glücklich? Die Familie des Protagonisten hat es zu etwas gebracht, das finanzielle Auskommen ist gesichert, auch wenn selbst diese Sicherheit im Fortschreiten der Geschichte immer brüchiger wird.
Ausführliche Figurenzeichnung
Ein ausführliches Kapitel hat Wood in seiner Kunst des Erzählens der Figurenzeichnung und ihren literarischen Traditionen gewidmet. Was macht eine lebendige, fiktionale Figur aus? Dieser Frage widmet sich Wood aus unterschiedlichen Perspektiven. Was haucht einer Figur Leben ein, löst sie heraus "aus ihrem erstarrten Aspik"?
In diesem Buch nähert sich Wood seinem Protagonisten zum Beispiel, indem er ihn in die Badewanne begleitet. Dieser gönnt sich ein Vollbad mit heißem Wasser und erinnert sich gleichzeitig an seinen Vater, der zur Abhärtung immer nur kalt badete. So haben wir nicht nur eine Vorstellung von dem Mann, wie er ist, sondern auch davon, wo er herkommt. Fest steht: Er will es gut haben.
Umso mehr schmerzt es ihn, dass seine Tochter leidet. Er beschreibt ihre – scheinbar grundlose – Verzweiflung mit einer Art "Farbenblindheit", mit der sie geschlagen sei. Sie kann die Farben des Lebens nicht wahrnehmen, alles wird ihr schwarz. Woher ihre Depression rührt?
Gewiss, die Trennung der Eltern war schlimm, aber die andere Schwester, Helen, ist eine energiegeladene Musikmanagerin, die um die Welt jettet und daneben noch erfolgreich ihre Zwillingskinder schaukelt.
Sehr lustig ist die Szene, in der ebendiese Helen mit ihrem Vater in New York angekommen ist und in einem Hipsterlokal vom Kellner beständig mit "Madame" angesprochen wird, nicht mit "Madam". Manchmal macht eben auch ein einzelnes "e" einen großen Unterschied.
Briten und Amerikaner
Während also der Vater in vielen Facetten vorgestellt wird – wir kennen seine Haltung zu Bidets, südafrikanischem Weißwein und Schluckauf –, bleibt Vanessa seltsam blass. Auch als die Geschichte endlich in Upstate angekommen ist, dazwischen weist sie doch einige Längen und Exkurse auf, kommen wir der jungen Frau nicht wirklich nahe.
Ihr Lebensgefährte Josh wird von Wood viel ausführlicher gezeichnet: Er ist ein schillernder, gefährlicher Charakter. In seinem Porträt schafft Wood es, viel von dem Unterschied zwischen Briten und Amerikanern anschaulich zu machen, ohne sie zu bloßen Karikaturen verkommen zu lassen.
Großartig sind seine Beschreibungen der winterlichen Kleinstadt Saratoga Springs, samt dem Hotel Alexandria, einem kolossal kitschigen Albtraum im Stile eines venezianischen Palazzos.
Wie es ausgeht, sei hier nicht verraten. Jedenfalls ist das Glück in diesem Roman wie der Gleichgewichtssinn: Denen er angeboren ist, für die ist das "Nicht-Umfallen" selbstverständlich. "Upstate" bleibt also auch in der Doppeldeutigkeit des englischen Wortsinns ein "state of mind". Glücklich die, denen er gegeben ist! (Tanja Paar, 2.3.2020)