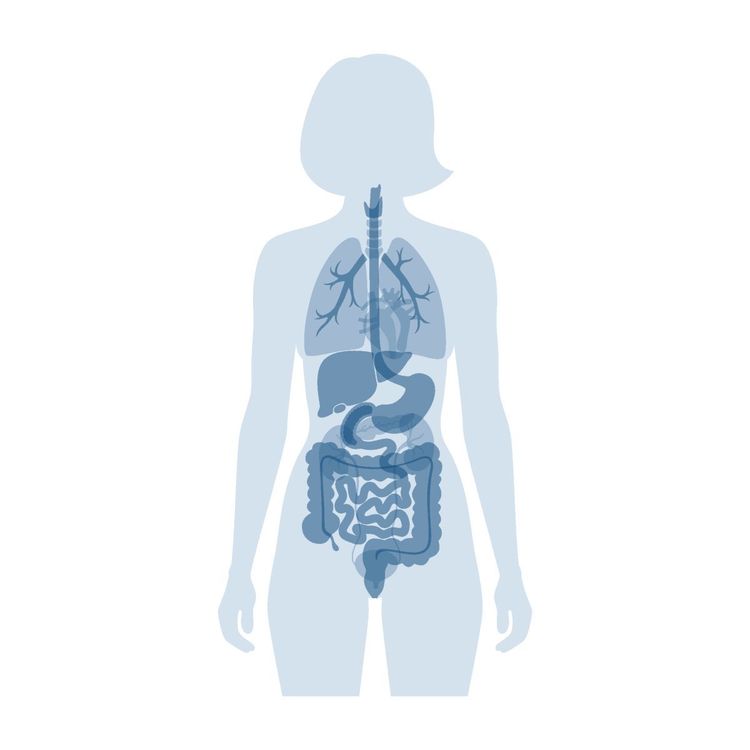
Frauen haben ein besseres Immunsystem, weil das Hormon Östrogen die Vermehrung von Viren hemmt. Dadurch sind Infektionskrankheiten für sie weniger gefährlich. Das zeigt sich auch an den Zahlen zum neuen Coronavirus. Zwar erkranken in etwa gleich viele Frauen wie Männer, doch es gibt deutliche Unterschiede in der Sterblichkeit: Während 2,8 Prozent aller infizierten Männer der Erkrankung erliegen, sind es nur 1,7 Prozent der infizierten Frauen.
Doch nicht nur bei Infektionskrankheiten gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen sind seltener Bluter oder farbenblind, leiden häufiger an Osteoporose und Schilddrüsenerkrankungen. Und: Frauen sterben entgegen der landläufigen Meinung häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer, diese dafür öfter an Krebs. Das wirkt sich auch auf unser Verhalten im Ernstfall aus, weiß Gendermedizinerin Margarethe Hochleitner von der Med-Uni Innsbruck. Sie erzählt: Bricht ein 60-jähriger Mann auf der Straße zusammen, wird sofort der Notarzt verständigt und von einem Herzinfarkt ausgegangen. Ist es hingegen eine 60-jährige Frau, "werden die Beine hochgelagert, der Traubenzucker ausgepackt, und alle gehen von einem Kreislaufkollaps oder einer Unterzuckerung aus".
Weniger dringlich
Für Frauen kann diese vorurteilsbehaftete Reaktion lebensgefährlich sein. Denn sie werden, das haben Studien gezeigt, von Laien seltener reanimiert und bei einem Herzinfarkt viel später medizinisch versorgt. "Viele kommen gar nicht auf die Idee, dass es dringend sein könnte", sagt Hochleitner. Und selbst wenn eine Frau die genau gleichen Herzinfarktsymptome wie ein Mann aufweist, "wird sie im Spital als weniger dringlich eingestuft", sagt auch Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Med-Uni Wien. Sie betont das, weil Frauen immer wieder auch an atypischen Herzinfarktsymptomen leiden. In der Welt der Medizin heißt atypisch aber: atypisch im Vergleich zum Mann – denn er ist die Norm. Yentl-Syndrom heißt das Phänomen, wenn Frauen mit Fehldiagnosen oder falschen Behandlungen konfrontiert sind, weil ihre Symptome nicht denen von Männern gleichen.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Angiogramm, ein Verfahren für die Diagnose eines Herzinfarkts. Es wurde an Männern entwickelt und zeigt blockierte Arterien. Doch diese sind bei weiblichen Herzinfarkten oft gar nicht verstopft. Nicht selten, so schreibt die Autorin Caroline Criado-Perez in ihrem Buch "Unsichtbare Frauen", werden betroffene Frauen daher wieder aus dem Spital entlassen, obwohl sie lebensbedrohlich krank sind. Auch der Test auf Blut im Stuhl spricht bei Frauen nicht gleich gut an, und Darmspiegelungen sind manchmal nicht vollständig, weil der weibliche Darm länger ist als der männliche. Auch bei Behandlungen ist es ähnlich. So warten Frauen in der Notaufnahme im Schnitt 16 Minuten länger auf schmerzstillende Medikamente als Männer.
Nur männliche Mäuse
Das eigentliche Problem beginnt jedoch viel früher – und zwar in der Forschung. Viele Medikamente wurden lange gar nicht und werden auch heute noch in einem viel zu geringen Prozentsatz an Frauen getestet. Selbst bei Erkrankungen, die zu einem größeren Teil Frauen betreffen, werden in nur zwölf Prozent der Studien im Tierversuch diese auch an weiblichen Mäusen durchgeführt.
Bei Studien an Menschen seien oft nur 25 oder 30 Prozent der Probanden weiblich, weiß Kautzky-Willer. Dabei handle es sich zudem meist um Frauen nach der Menopause. Denn die große Angst der Forscher ist, dass Frauen im Untersuchungszeitraum schwanger werden und das Ungeborene Schaden nimmt. Kautzky-Willer kritisiert, dass es dadurch so gut wie keine Daten zur Wirkung von Medikamenten bei Schwangeren gibt: "Viele Frauen nehmen ja welche, weil sie noch nicht wissen, dass sie schwanger sind." Bestimmte Medikamente könnten natürlich für Ungeborene gefährlich sein, doch es würden nicht einmal Daten gesammelt, schreibt auch Criado-Perez. So wurden etwa bei der Sars-Epidemie 2002/2003 in China die Krankheitsverläufe von Schwangeren nicht dokumentiert. Es sind Daten, die beim aktuellen Sars-CoV-2-Ausbruch fehlen.
Ein weiterer Grund: Werden Frauen eingeschlossen, sind mehr Studienteilnehmerinnen erforderlich, denn die Ergebnisse können nach Zyklusphasen variieren. "Es ist eine reine Kostenfrage, dass zu wenig an Frauen getestet wird", sagt Hochleitner.
Andere Wirkung
Ähnlich ist die Lage bei präklinischen Studien. Viele werden schon nach den ersten Tierversuchen abgebrochen, weil sie bei männlichen Mäusen nicht aussichtsreich erscheinen. Das heißt: Ob sie eventuell am weiblichen Organismus Effekte haben, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. 90 Prozent aller Tierversuche würden an männlichen Mäusen durchgeführt, schreibt Criado-Perez.
Auch die Forschungslage an sich ist männerlastig: Obwohl das Prämenstruelle Syndrom (PMS) 90 Prozent aller Frauen betrifft, gibt es fünfmal so viele Studien zur erektilen Dysfunktion, an der zwischen fünf und 20 Prozent aller Männer leiden.
Die Folge: Viele Medikamente, die für beide Geschlechter zugelassen sind, sind nicht ausreichend an Frauen erforscht. Dass es Unterschiede in der Wirkung gibt, liegt an vielen Faktoren: Frauen haben mehr Fettmasse und einen niedrigeren Wassergehalt, weniger Magensäure. Nieren und Leber arbeiten langsamer. Die Verweildauer von Medikamenten im Körper ist daher länger. In der Folge wirken Arzneimittel häufig anders oder stärker. Nicht selten zeigt sich das erst, wenn ein Medikament schon im Einsatz ist und bei Frauen vermehrt Probleme verursacht. Sie litten zu 50 bis 70 Prozent häufiger unter Nebenwirkungen als Männer, so Kautzky-Willer.
Zwei Präparate
Bekannt sind unterschiedliche Effekte etwa bei Chemotherapie, Grippeimpfung, Aspirin, Cholesterinsenkern, Morphin und Opioiden. "Es kann Riesenunterschiede geben", sagt Hochleitner und ist sich sicher, dass es bald unterschiedliche Präparate für Frauen und Männer geben wird. Wie zuletzt beim Schlafmittel Zolpidem in den USA, das für beide Geschlechter mit zehn Milligramm erhältlich war, nach zahlreichen Vorfällen vom Markt genommen und dann für Frauen mit fünf Milligramm erneut zugelassen wurde.
Neben allen biologischen Faktoren werden Frauen als Patientinnen auch häufiger nicht ernst genommen und "abgewimmelt", wie Hochleitner es nennt. So werden dann Beruhigungsmittel verschrieben und "Frauen schnell psychiatriert", so die Medizinerin. Nicht unwesentlich ist übrigens auch, ob Frauen auf einen Behandler oder eine Behandlerin treffen. Werde eine Herzinfarktpatientin von einer Ärztin behandelt, habe sie bessere Überlebenschancen, so Kautzky-Willer.
Von Gendermedizin könnten im Übrigen beide Geschlechter profitieren, denn manche Dinge laufen im weiblichen Körper auch besser als im männlichen. So könnte, sagt Hochleitner, das, "was beim einen Geschlecht gut funktioniert, die Lösung für das andere sein". (Bernadette Redl, 3.3.2020)