Mama Afrika hat Grippe. Sie sitzt auf einem der weißen Plastikstühle in ihrem Restaurant, am Tisch vor dem Gang zur Küche, in Tapachula, Mexiko, 20 Kilometer von der guatemaltekischen Grenze entfernt.
Ihre rosarote Bluse ist ein bisschen verschwitzt, die Stimme schwach. Trotzdem redet sie tapfer gegen den Straßenlärm und das Stimmengewirr an: "Ich verkaufe seit vierzehn Jahren Essen, aber vor acht Jahren, als die Migranten kamen, habe ich gelernt, wie sie zu kochen."
Bild nicht mehr verfügbar.
Eigentlich heißt Mama Afrika Hermila Hernández Lopez, doch unter diesem Namen kennt sie hier niemand. Um sie besser finden zu können, haben sie ihre Gäste umgetauft. "Diejenigen, die schon in den USA sind, erzählen ihren Familienmitgliedern, die die Reise noch vor sich haben, von mir und dass sie hier essen gehen sollen."
Früher habe sie ganz normal gekocht, mexikanisch. Doch die Männer, die aus Somalia, Ghana, Kenia und noch vielen anderen Ländern zu ihr kamen, erklärten ihr, dass ihnen das nicht schmecke. Also bat Mama Afrika die Ankömmlinge, ihr die Gerichte beizubringen, die sie so vermissten. "Zuerst bin ich mit einem Somalier über den Markt gegangen und dann an den Herd. Dann hat mir ein Mann aus Bangladesch gezeigt, wie man Curry zubereitet, und so weiter."
200 bis 300 mehr Afrikaner
Dass Mama Afrika jetzt Curry kocht, liegt auch an den europäischen Außengrenzen. Enrique Vidal Olascoaga (35) von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Fray Matias erklärt, dass die europäische Migrationspolitik, die sich in den letzten fünf Jahren immer weiter verschärft habe, dazu führe, dass immer mehr Afrikaner den Weg über Ecuador oder Brasilien durch Süd- und Zentralamerika gehen, um in den USA nach einer besseren Zukunft zu suchen.
Die Auswirkungen spüre man hier vor allem seit drei Jahren. An der Grenze zwischen Kolumbien und Panama haben Hilfsorganisationen 2017 200 bis 300 Prozent mehr Afrikaner gezählt als in den Jahren davor. Seitdem bleiben die Zahlen konstant.
Mama Afrika weiß nicht viel über die Außenpolitik der Europäischen Union. Sie kümmert sich ums Essen, und wenn es einem ihrer Gäste schlecht geht, vermittelt sie einen Arzt. Aber heute ist nur sie krank. Trotzdem dirigiert die kleine Frau mit dem angegrauten Haar und der leisen Stimme das Treiben in der Hitze ihres Restaurants mit der Gelassenheit einer hundert Jahre alten Schildkröte.
Inzwischen ist die Vitrine, die mitten im Raum steht, gefüllt mit Curry, Reis, Fisch, Huhn und Rind. Ein Teller kostet 50 Pesos, das sind 2,50 Euro. Wer möchte, bekommt auch Bohnen. Kaffee ist gerade schwierig, denn der Herd ist noch mit Kochtöpfen belegt. Mama Afrika sitzt, erzählt und schwitzt wie alle anderen auch. Im Moment mache sie sich Sorgen, um einen ihrer Gäste aus Eritrea. Er habe eigentlich erfolgreich Asyl in Italien beantragt, sei jetzt aber hier, und die Behörden wollen ihn zurück in sein Herkunftsland schicken.
Auf die Nachfrage, was er hier mache, wenn ihm Italien Asyl bietet, zuckt Mama Afrika die Schultern. "Es un poco loco", psychische Probleme, sagt sie und unterstreicht ihre Worte mit einem kreisenden Zeigefinger an der Schläfe.
Sie sei aber keine Hilfsorganisation, betont sie plötzlich mit fester Stimme. "Ich bin nur abhängig von Gott und den Menschen, die zum Essen kommen", man müsse schließlich auch irgendwie seine Miete zahlen.
Mama Afrika
Die Afrikaner, die in Mexiko ankommen, haben meist schon lange kein heimisches Essen mehr gesehen. Flüchtlingshelfer Enrique Vidal Olascoaga spricht von einem bis fünf Jahren, die die Afrikaner schon unterwegs sind, wenn sie hier ankommen.
Ismael* (21) und Samuel* (25) sitzen bei Mama Afrika am Tisch. Ismael ist klein und muskulös, er spricht wenig und leise auf Portugiesisch und Französisch. Samuel ist groß und drahtig, er spricht laut und viel auf Kreol und Spanisch. Die beiden haben sich in Kolumbien kennengelernt.
Ismael hat die Elfenbeinküste vor zwei Jahren mit seiner Mutter und seinem neunjährigen Halbbruder im Flugzeug Richtung Brasilien verlassen. Dort war es besser, aber auch nicht gut. Jetzt haben auch sie sich auf den Weg Richtung Norden gemacht. Auch weil es der Vater seines kleinen Halbbruders geschafft hat. Er ist schon in den USA und will seine Familie nachholen. Ismael bleibt aber in Mexiko. Auf der Reise verliebte er sich in ein Mädchen aus Honduras, sie ist jetzt in Monterrey im Norden Mexikos. Er wartet also nur noch auf die Papiere, die es ihm erlauben, sich frei in Mexiko zu bewegen, dann fährt er weiter nach Norden.
Samuel kommt aus Haiti und hat sich 2017 nach Chile aufgemacht. Die letzten zwei Jahre waren gut dort. Doch wegen der aktuellen politischen Unruhen um den Präsidenten Sebastián Piñera hat auch er beschlossen, im Norden ein besseres Leben zu suchen.
Die Reise durch den Süden, über Brasilien oder Chile, Peru und Ecuador, hört sich immer gleich an: Von Grenze zu Grenze in Bussen für je 30 Dollar, und dann wartet an jeder Grenze ein Polizist auf seinen Anteil.
In Ecuador landen die meisten Migranten aus Afrika in Flugzeugen, da das Land keine Visa verlangt. Von dort aus geht es weiter nach Kolumbien. Dann kommt El Darién, ein Regenwaldgebiet im Nordwesten Kolumbiens und im Südosten Panamas. Die letzte Lücke in der Panamericana, der Straße, die das südamerikanische Feuerland mit Alaska verbindet.
Im Dschungel
Ein Ort, an dem Traumata entstehen. Ismael und Samuel sind mit 41 anderen sieben Tage lang durch diesen Dschungel gelaufen. Sechs Stunden bergauf, dann drei Stunden bergab, dann durch den Fluss und am nächsten Tag über den nächsten Berg.
Samuel: "Wenn du deinem Schlepper nicht genug zahlst, zeigt er dir nicht den Weg nach Panama, sondern den zu seinen Freunden, die dich überfallen und verschwinden lassen."
Ismael: "Ein Mann aus unserer Gruppe ist vorangegangen. Später haben wir Blut auf dem Weg gefunden. Als wir ihn nach drei Tagen immer noch nicht wiedergesehen hatten, war uns klar, wessen Blut es war."

Samuel hat es sich im Dschungel zur Aufgabe gemacht, seine Gruppe zu beschützen, denn er wisse sich zu verteidigen, sagt er. In Chile habe er Karate und Boxen gelernt und wie man mit einer Machete umgeht. Im Dschungel lag er mit seiner Machete nachts wach in der Hängematte. Er habe die ganze Nacht Joints geraucht, aber nicht geschlafen.
Ismael nickt andächtig, wenn Samuel erzählt. "Wir hatten Bohnen, Reis, Butter und Kekse dabei, aber wir dachten, der Weg dauert drei bis vier Tage. Auf halber Strecke ist uns das Essen ausgegangen."
Samuel: "Als die anderen nichts mehr hatten, habe ich mein Essen aufgeteilt, Löffel für Löffel und Keks für Keks an die Frauen und Kinder." Drei Tage habe er nichts gegessen, dafür habe er die Frauen und Kinder, die nicht mehr konnten, abwechselnd getragen.
Samuel hat unterwegs in den Flüssen gefischt, doch sie konnten nie lange haltmachen. Schnell weiterzugehen war das oberste Gebot zum Überleben. Nach acht Tagen kamen sie am Panamakanal an. Für zehn Dollar setzen sie mit einem Kanu über den Fluss.
Samuel: "Im ersten Lager gab es weder Essen noch Pomade für die zerschnittenen Füße. Nur schreiende Frauen, die sich freuten, weil sie überlebt hatten, aber weinten, weil immer noch kein besseres Leben in Sicht war."
Ismael: "Wer es nicht ins erste Camp geschafft hat, den wird man nie wiedersehen. Der Dschungel entscheidet über Leben und Tod."
Alle da, aber keiner hier
Auch Enrique Vidal Olascoaga bestätigt, dass viele der Menschen, die Unterstützung im Human Rights Center Fray Matias suchen, ein Familienmitglied im Darién-Regenwald verloren haben und dessen Körper im Dschungel zurücklassen mussten. Ismaels Mutter und sein kleiner Halbbruder haben es geschafft. Samuel ist Vollwaise, seitdem er vier Jahre alt ist, seine Geschwister wohnen in ganz Amerika verstreut, er konnte niemanden mehr auf dieser Reise verlieren.
Bei Mama Afrika sitzen immer noch dieselben Gäste an den Tischen. Die meisten aus Bangladesch, ein paar Nepalesen, Ismael ist der einzige Afrikaner. "Früher sind die Leute durch Tapachula durchgereist auf ihrem Weg nach Norden, heute bleiben sie hier. Sie mieten Wohnungen, gehen auf den Markt und kochen sich ihr eigenes Essen. Das sind harte Zeiten für mich", erklärt Mama Afrika.
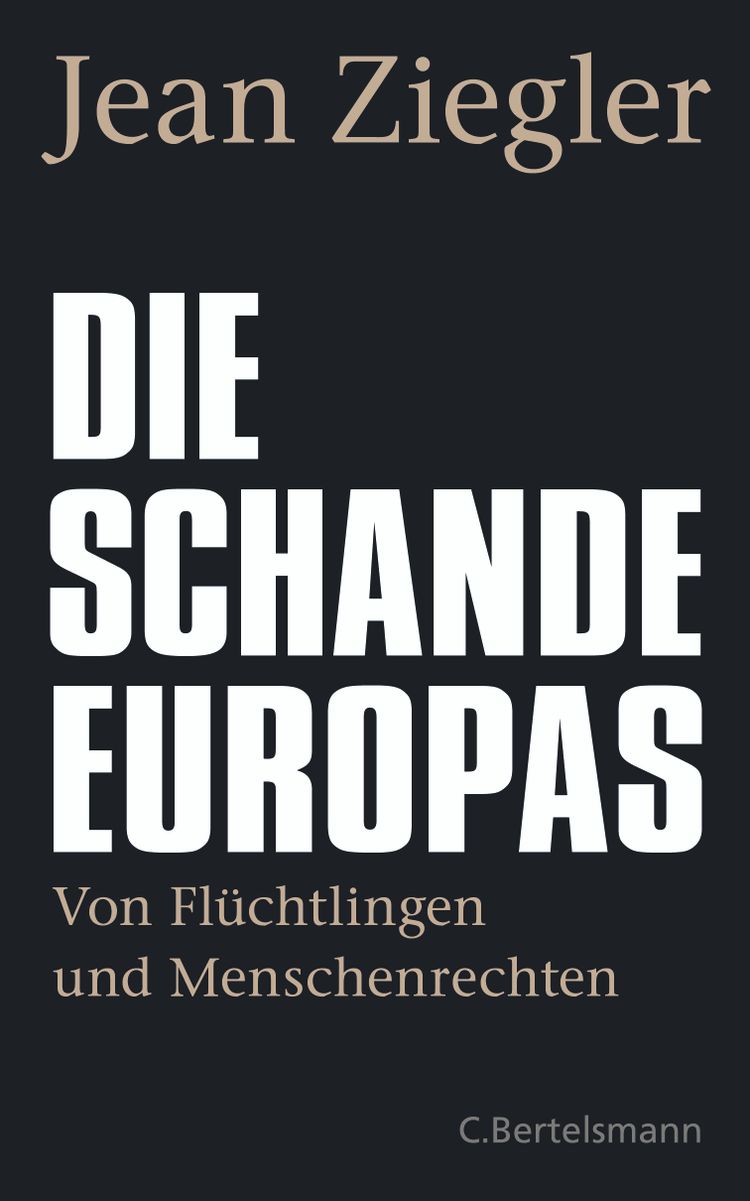
Im Mai vergangenen Jahres drohte Trump dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador mit Strafzöllen, sollte er nicht dafür sorgen, dass die nach Norden strömenden Migranten der US-amerikanischen Grenze fernblieben. Mexiko funktioniere wie eine Pufferzone der USA, erklärt Enrique Vidal Olascoaga. "Es ist ein perfektes Beispiel für das geopolitische Phänomen der Grenzauslagerung: Ein starkes Land setzt seinen südlichen Nachbarn, der wirtschaftlich oder politisch von ihm abhängig ist, unter Druck, um so die eigene Grenze zu verstärken beziehungsweise zu verschieben." Ein europäisches Äquivalent sei zum Beispiel Griechenland oder die Türkei.
Davor verbrachten die meisten Migranten, die nach Mexiko kamen, ein paar Tage in Haft und bekamen dann ein Ausreisedokument mit der Anordnung, das Land innerhalb von zwanzig Tagen zu verlassen. Ob über die nördliche oder südliche Grenze, war dabei egal. Dieses Dokument wird seit den Gesprächen mit Trump fast nicht mehr ausgestellt. Stattdessen wurde die südliche Grenze Mexikos militarisiert und die Zahl der Festnahmen und Deportierungen erhöht.
Das Problem mit den Migranten aus Afrika ist, dass es in Mexiko kein Konsulat ihrer Herkunftsländer gibt und somit auch keine Rückführungsabkommen. Als Resultat hängen die Menschen über Monate in Tapachula fest.
Inzwischen werden die Verfahren der Afrikaner schneller bearbeitet als die der Haitianer. Ihnen wird vermehrt eine Aufenthaltserlaubnis für Mexiko ausgestellt. Wie sich diese auf ihre Chancen, in den USA Asyl beantragen zu können, auswirkt, weiß keiner. Enrique Vidal Olascoaga erklärt: "Das Verfahren ist total improvisiert und willkürlich, es hat überhaupt kein gesetzliches Fundament. Aber Tapachula ist wie ein Stöpsel, den man hin und wieder lösen muss, da sonst alles überläuft."
Ismael erwartet seine Aufenthaltserlaubnis in der nächsten Woche. Dann geht es für ihn weiter zu seiner Freundin nach Monterrey. Samuel muss noch fünf Monate warten, wenn er nicht vorher abgeschoben wird.
Jetzt gehen die beiden erst einmal weiter, von der Mama zum Casa Afrika. Ein Haus, nur zwei Straßen vom Restaurant entfernt, in dem viele der Afrikaner wohnen und essen, die früher vielleicht zu Mama Afrika ins Restaurant gekommen wären.
Paiere für Mexiko
In dem kargen Hof hinter einer roten Metalltür stehen Stühle und Tische zwischen einer Theke aus Beton und dem Bereich, in dem gebetet und geschlafen wird. Es läuft Fußball: Getafe gegen Valencia.
Samuel treibt die Spieler an, Ismael starrt vor sich hin. Neben ihnen sitzt Derrick*, ein Mittzwanziger aus Ghana, der Hip-Hop-Musik auf seinem Handy spielt. Mit seinem Basketballtrikot und der überdimensionalen Basecap sieht er aus wie ein US-amerikanischer Collegestudent mit Sportstipendium. Ob er schon mal in den USA war? Sein Grinsen verrät, dass diese Frage genau die Reaktion ist, die er mit seinem Outfit erzielen wollte. "Nein, aber ich schaue viele amerikanische Filme."
Neben ihm sitzt Joseph*. Er ist Mitte 50 und spuckt Gräten auf seinen Teller. Als er noch in Ghana war, habe er einer Deutschen 1000 Dollar überwiesen, sie hatte versprochen, ihn zu heiraten, damit er eine Aufenthaltserlaubnis bekäme. Doch sobald er das Geld überwiesen hatte, habe er sie nicht mehr erreicht.
"Ich würde alles tun, um nach Deutschland zu kommen", ruft er. Eigentlich sei er mit seiner Frau hier, doch wenn er eine Möglichkeit bekäme, nach Deutschland zu kommen, würde er sie im Zweifelsfall auch zurücklassen. Mit bitterem Gesichtsausdruck spuckt er weitere Gräten auf den Teller. "Ich brauche einfach nur Geld!"
Wir brauchen Geld!
"Wir brauchen alle Geld", antwortet Adama* aus der Côte d’Ivoire. Der 40-Jährige ist bereits seit einem halben Jahr von seiner Frau und seinem inzwischen zweijährigen Sohn getrennt. "Ich weine jeden Morgen, weil ich sie so vermisse", sagt er ernst. In drei Wochen bekomme er seine Aufenthaltspapiere für Mexiko, dann möchte er im Norden Arbeit finden, denn hier in Tapachula sei es aussichtslos. Er denkt, nach zwei Monaten genug Geld verdient zu haben, um seiner Frau und seinem Sohn den Flug nach Mexiko bezahlen zu können. Dann wollen sie zu dritt über die Grenze in die USA.
Adama isst weder bei Mama Afrika noch in der Casa Afrika. Er läuft später zum Supermarkt und kauft fünf Brötchen und drei Päckchen Brause, die Wasser zu Saft werden lässt. Insgesamt kostet sein Einkauf 15 Pesos, nicht einmal einen Euro. Ein bisschen Tomatensoße hat er noch zu Hause. Wann er das letzte Mal afrikanisch gegessen hat, weiß er nicht mehr. (Pola Kapuste, ALBUM, 15.3.2020)