Man will es nicht glauben. Da gibt es eine italienische Autorin, die dermaßen brillant schreibt, dass beim Lesen der Atem stockt und man jeden Satz zwei-, drei-, ja viermal liest. Und doch ist Anna Maria Ortese, 1914 in Rom geboren, von 1928 bis 1953 in Neapel ansässig, danach in sehr ärmlichen Verhältnissen in Rom am Rand der Literaturszene lebend und seit 1975 in Rapallo, wo sie 1998 starb, hierzulande so unbekannt, dass es schmerzt.

Vor mehr als 25 Jahren erschienen drei Bücher von ihr auf Deutsch, das Echo auf ihre rätselhaft klare, romantisch-surreale Anderswelt war eher überschaubar. Nun erscheint im Zuge einer neuerlichen Renaissance Orteses in ihrem Heimatland, lange Jahre Reporterin, weil sie von ihren langsam geschriebenen Büchern nicht leben konnte ("Weil ich die richtige Maske für das Leben in der Gesellschaft nicht fand, blieb ich immer arm und immer einsam wie eine Katze"), ihr Erzählband Neapel liegt nicht am Meer von 1953, für eine Neuauflage 1994 ergänzt um zwei kurze Texte, auf Deutsch.
Neapel erscheint bei ihr düster, karg und elend. So spielt Die Brille im ärmsten Hinterhofgebäude des ärmsten Stadtbezirks und endet in deprimierender Klarsicht. Die Familie ist der Totentanzmonolog einer Enddreißigerin, die ihre ganze Familie mit einem Kurzwarenladen über Wasser hält, nur Arbeit und Wohnung kennt. Als sie hört, ein Mann sei zurückgekehrt, vor zwanzig Jahren ihr heimlicher Schwarm, entfaltet sie sich innerlich, hofft auf Wiedersehen und Erlösung – und wird beklemmend enttäuscht. Denn er kommt nicht, er wird nie kommen. Sie bleibt lebendig begraben.
Neapel im Regen
Dass Ortese nach Erscheinen des Buchs Neapel Hals über Kopf verlassen musste, verwundert angesichts des längsten Textes, einer hundert Seiten langen Gruppenanalyse der kritisch-literarischen neapolitanischen Intelligenzija um 1950, nicht. Atemberaubend böse, von heiterer Häme, die alle Verlogenheiten aufzählt, und von schneidender Entzauberung der Selbstlügen ist dieses Porträt. Orteses Erzählungen wurde auch ein ausnehmend schönes Buchkleid geschneidert, und der Band wird von einem hochinformativen Nachwort flankiert.

In Malacqua, dem Neapel-Roman des Journalisten Nicola Pugliese (1944–2012), das sein einziger Roman bleiben sollte, ist Neapel von Wasser vollgesogen. Vier lange Oktobertage regnet es ununterbrochen, in einer Straße öffnet sich ein Loch und verschluckt zwei Frauen, in einer anderen Gasse kollabiert ein baufälliges Haus und begräbt eine fünfköpfige Familie. Es regnet und regnet in diesem Buch, das 1977 in Italien erschien, gelobt und gepriesen, nacheinander von zwei großen Verlagen aufgelegt, dann aber fast vergessen und erst 2013 nachgedruckt wurde, ganze Ströme fluten durch die Stadt.
Pugliese hat enorm viel von modernistischen Autoren und Zeitgenossen gelernt und in völlig unjournalistische Prosa verwandelt, in barock und atemlos mäandernde Sätze wie bei Luigi Manganelli, in zahlreiche Perspektivsprünge von Person zu Person – und es taucht eine stattliche Reihe auf, vom Zeitungsredakteur, einer Zwölfjährigen bis zu einer unbefriedigten Ehefrau und einem Feuerwehrmann, der sich mit einer mysteriös stöhnenden Puppe konfrontiert sieht – von John Dos Passos.
Doch die große, alles überschattende Hauptfigur ist Neapel, die Stadt, die als fragil erscheint, unterspült, grausam und als Untergeherort, von der Politik im Stich gelassen und geschunden. Dass dieser Roman nun erstmals in deutscher Übersetzung erscheint, einer guten der Niederösterreicherin Barbara Pumhösl, ist eigentlich unerhört. Denn dieser Roman ist wirklich beeindruckend.
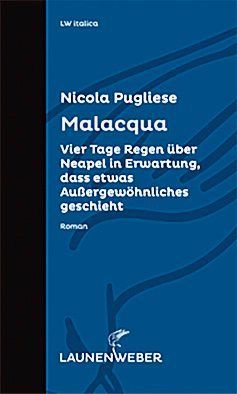
Vom magischen Rom
"Das war es, was denjenigen, der Rom wirklich sah, zu einem Eingeweihten antiker Kulte machte. Es ging um den Übergang von einem Zustand, in dem die Realität einfach nur das ist, wie sie scheint, in einen anderen, in dem die Realität verdoppelt wird und deren Zeichen Hilfestellungen für die sind, die sich verlieren wollen, um alles zu verlieren." Vom arkanen, heimlichen Rom, einem magischen Rom erzählt der 34-jährige Matteo Trevisani in seinem in Italien 2017 erschienenen Romandebüt Buch der Blitze auf kluge wie gelehrte Weise.
Sein Protagonist Matteo, wie sein Schöpfer nebenbei Mitarbeiter einer Kulturzeitschrift, wird verwickelt in ein undurchschaubar magisches wie erotisches Spiel um Blitze und von Blitzen markierte Gräber, eine Welt hinter der realen Welt und antike Magie. Beschreibt Trevisani Rom zu Beginn satt und sehr konkret, so biegt er rasch ab in psychoarchäologische, halluzinatorische Überschreibungen der römisch-etruskischen Vergangenheit, genährt von einer gutsortierten Privatbibliothek und alten Geheimnissen.
"Ich bin Gott. Ich war es immer schon, ich werde es immer sein. Ein immer allerdings mit messerscharfen diamantenen Lichtreflexen, ohne Entsprechungen in den Sprachen der Menschen." In diesen beiden Auftaktsätzen von Giacomo Sartoris Göttlichem Tagebuch ist scharf gestellt, was folgt: Glanz, Brillanz, ätzende Reflexion der Welt und satirische Reflexion des allzu Irdischen. Alles aus der Warte Gottes geschildert.

Vor 35 Jahren spielte Franco Ferrucci im Roman Die Schöpfung. Das Leben Gottes, von ihm selbst erzählt ein postmodernes Spiel mit Gott und all dem, was er in den ersten sieben Tagen so anstellte. Bei Sartori schaut Gott auch auf die Welt. Und reibt sich verwundert die Augen. Nicht nur was die Menschen so treiben. Sondern was in seinem Namen alles so geschieht. Und dann fällt sein Auge auf eine junge, schlanke Naturwissenschafterin, die sich nebenbei Geld als Kuhbesamerin verdient und als Hobby Kruzifixe im Kamin ihrer SubStandardwohnung verbrennt.
Er verliebt sich in sie, sofern ein Gott das kann, und verfolgt ihr berufliches wie amouröses Auf und Ab. Das ist witzig, amüsant, jedes der vielen kurzen Kapitel ist reich an Esprit. Der 1958 geborene Sartori, Agronom und Schriftsteller aus Trient mit Zweitwohnsitz in Paris, hat das Schicksal vieler geistreicher Gegenwartsautorinnen und -autoren des mittelmeerischen Stiefellandes geteilt, hierzulande von Verlagen ignoriert zu werden. Bisher.
Sinkflug eines Königreichs
Würde man einen Roman gerne in die Hand nehmen, der Die Pardelkatze heißt? Leopard dagegen, das ist etwas ganz anderes, das verheißt Sprungkraft, Vitalität, Energie, rauschhaftes Erzählen. Der Roman Der Leopard des sizilianischen Adligen Giuseppe Tomasi di Lampedusa ist seit 1958 ein Begriff und ein Monument der italienischen Literatur nach 1945. Zwischen Mai 1860 und Mai 1910 vollzieht sich die Handlung.

Ort, Sujet und Motiv: Sizilien. Zu einem Italien gehörig, das zu Beginn des Romans in Aufruhr ist. Das Königreich Sizilien ist im Sinkflug begriffen, Garibaldi und seine Revolutionäre, die berühmt gewordenen "Mille", die tausend, gerade in Marsala gelandet und auf ihrem Triumphzug zur Einigung der italienischen Lande unterwegs.
Fürst Federico Salina, Herr über ein kleines, stetig schrumpfendes Imperium von Latifundien und Lehensdörfern, fühlt sich als Letzter seines Geschlechts. Trotz Nachkommenschaft, trotz allseits ihm bekundeten Respekts in Palermo wie auf dem Lande empfindet er sich als Figur des Niedergangs. Die Republikaner bedrohen seine spätfeudale Lebensform wie das Bürgertum mit ehrgeizigen, kaufmännisch beschlagenen, verschlagenen Vertretern, die ins Machtzentrum drängen.
"Es muß sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist." Diese dialektische Sentenz erweist sich als Trug. Denn das Versiegen der Kräfte ergibt keine Renaissance des Adels; der Fürst macht sich keine Illusionen, auch wenn er diese Gedanken zur Seite schiebt und sich darein schickt. Er gibt ihnen eskapistisch nach, widmet sich der Astronomie, pflegt kleine unbedeutende Affären und hat sich einen Mantel aus Inaktivität, halb klarsichtiger Reflexion und Fatalismus zugelegt.
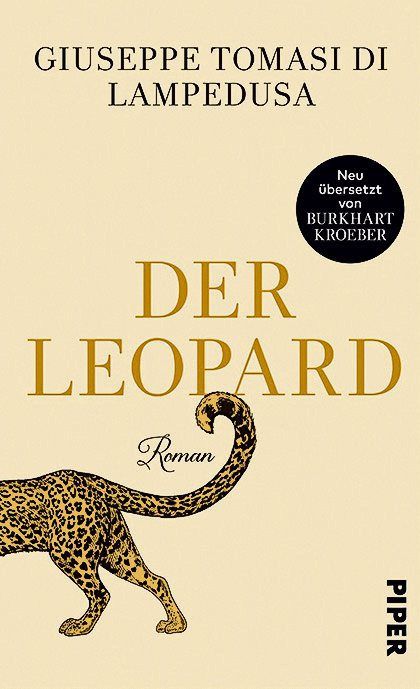
Darin ganz sizilianisch: "Alle sizilianischen Handlungen sind geträumte Handlungen, auch die gewalttätigsten, unsere Sinnlichkeit ist Verlangen nach Vergessen, unsere lupare [die abgesägten Jagdflinten] und unsere Messerstechereien sind Todessehnsucht; Sehnsucht nach wollüstiger Erstarrung, also wiederum nach Sterben; unsere Trägheit, unsere Rauhweizen- oder Zimtsorbetts; unser meditativer Anschein ist der des Nichts, das die Rätsel des Nirwana erforschen möchte."
Der Leopard, Elegie und sarkastisches Porträt, ist das Buch des verarmten Adligen Tomasi di Lampedusa, der die meiste Zeit seines Lebens das Nichtstun pflegte. Nach 1945, der Palast der Familie war im Krieg schwer beschädigt worden, widmete er sich vor allem Freunden und der Lektüre. Erst 1954 fing er die Arbeit am Manuskript an. Veröffentlichung und Weltruhm erlebte er nicht mehr; schon die letztgültige Überarbeitung des Typoskripts konnte er, der 1957 starb, nicht mehr abschließen.
Wieso ein Buch in neuer Übersetzung vorlegen, von dem es seit 2004 eine Neuübersetzung gab, die die erste aus dem Jahr 1959 ablöste? Legt man jene von Giò Waeckerlin Induni neben die neue von Burkhard Kroeber, so stellt man fest, dass Kroebers Version glanzvoller ist, linguistisch aufstrahlender. Die sinnliche Sprache des Originals findet in ihm, vor allem bei den Dialogen, einen so peniblen wie sprachlich machtvollen Wiedergeber. Tatsächlich eine Übersetzung für unsere Zeit. (Alexander Kluy, 4.4.2020)