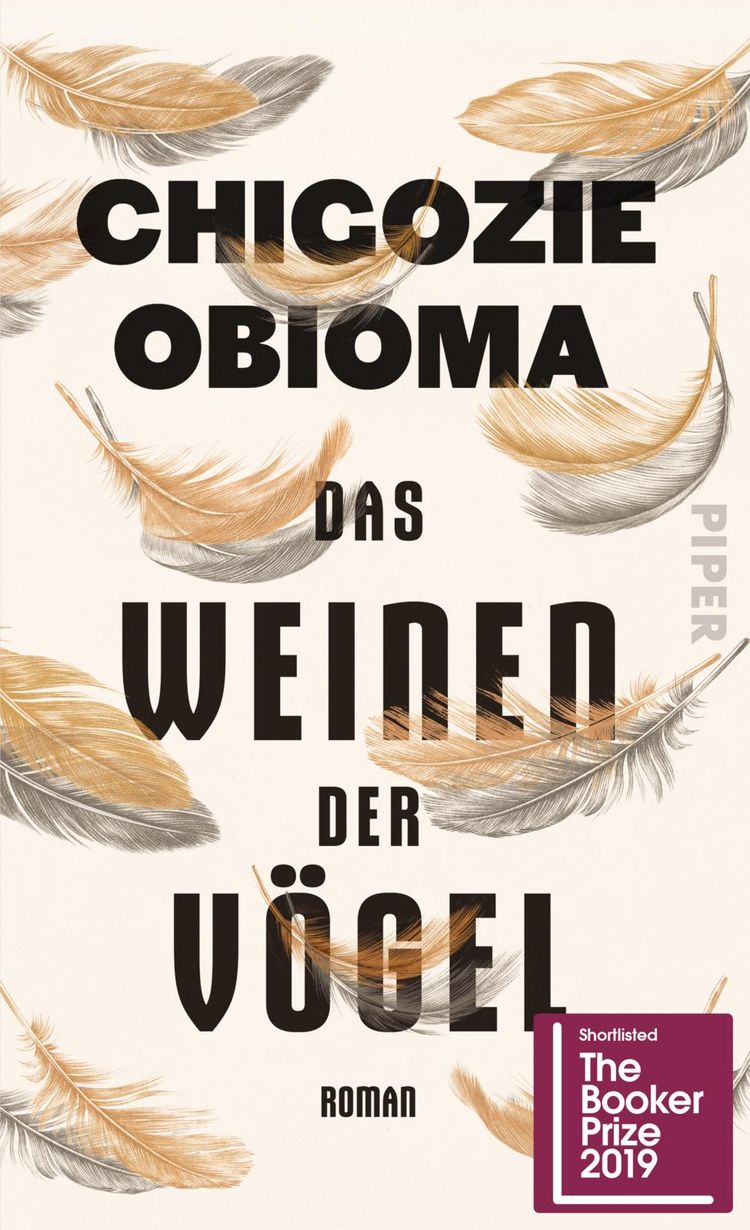In Zeiten der Corona-Pandemie scheint Chigozie Obiomas Das Weinen der Vögel genau die richtige Botschaft zu verbreiten – zeigt der gut 500 Seiten starke Roman doch, was einem Menschen alles passieren kann, wenn er sein Zuhause verlässt.
Die Hauptfigur Chinonso hat eine Hühnerfarm im nigerianischen Umuahia. Eines Nachts hält er eine Frau, Ndali, davon ab, von der Brücke zu springen – eine Begegnung mit verheerenden Auswirkungen. Die beiden verlieben sich ineinander, möchten heiraten, doch Ndalis wohlhabende, gebildete Familie lehnt den einfachen Hühnerzüchter ab. Die Demütigungen, die Chinonso durch sie erlebt, werden zur Triebfeder des Unglücks in diesem Roman – oder des "Schicksals", wie es raunend schon im Klappentext heißt.
Um Ndali nicht zu verlieren, beschließt Chinonso, auf Zypern zu studieren. Dass sie ihn unbedingt zurückhalten will, nimmt er nicht ernst. Der alte Schulfreund, der vorgibt, ihm helfen zu wollen, betrügt ihn um sein Geld. Mittellos und desillusioniert kommt er in Zypern an. Dort landet er unschuldig im Gefängnis, erlebt Schlimmstes und kehrt nach Jahren traumatisiert zurück. So viel in Kürze zur leicht kolportageartigen Handlung, die sich streckenweise aber schwerfällig dahinzieht.
Schon für seinen Debütroman Der dunkle Fluss wurde Obioma für den Booker Prize nominiert, auch Das Weinen der Vögel, im Original An Orchestra of Minorities, sein zweiter Roman, stand 2019 auf der Shortlist. Das liegt sicher auch an der gewagten (oder genau auf diesen Eindruck hin kalkulierten und konstruierten) Erzählperspektive. Dafür hat Obioma sich an der Kosmologie der Igbo bedient. Die Geschichte des Chinonso Solomon Olisa wird weder von ihm selbst noch von einem Erzähler berichtet, sondern von einem Zwischending: seinem Schutzgeist, seinem Chi, der in seinem Körper steckt und alles miterlebt, aber auch aus ihm heraustreten kann. Der seine Gedanken und Träume kennt, aber nicht in sein Handeln eingreifen kann. Lediglich Gedanken kann der Chi seinem Schützling schicken.
Das heutige Nigeria
Wie schlecht dieser Chi seinen Job erledigt hat, wird gleich zu Beginn klar, als er bei den Göttern vorstellig wird. "Ich komme, um für meinen Schützling zu sprechen, denn für das, was er getan hat, muss Ala, die Hüterin der Erde, Vergeltung fordern – denn Ala sagt, niemand darf einer schwangeren Frau Leid antun, ob Mensch oder Tier –" Chinonso wird Ndali töten. Den ganzen Roman über versucht sein Chi zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Wie er gedemütigt, traumatisiert und verbittert nach Nigeria zurückkehrt und verzweifelt nach Ndali sucht. Sie schließlich findet, aber als Frau eines anderen Mannes. Obioma entwirft in den ausschweifenden Erzählungen des Chi, der sich immer wieder an frühere Reinkarnationen erinnert, ein detailliertes Panorama der nigerianischen Geschichte von den Sklavenmärkten bis zum Biafra-Krieg. Aber er zeigt auch das heutige Nigeria, zerrissen zwischen wohlhabenden Eliten und Armut, westlichen Standards und dem Festhalten an Traditionen, zwischen der christlichen Religion des "weißen Mannes" und der Igbo-Kosmologie der "alten Väter". Immer wieder ist auch die Sprache Thema, die Figuren sprechen, je nach Anlass Englisch oder Igbo.
Was aber nachhaltig irritiert, das ist die Lesart, die bereits im Klappentext vorgeschlagen wird: jene nämlich, die das Ganze als "universelle Geschichte von einem" sieht, "der gegen das Schicksal aufbegehrt". Ein ominöses Schicksal soll schuld daran sein, dass aus Liebe Hass und Zerstörungswut werden und am Ende ein Mensch gewaltsam zu Tode kommt. Immer wieder wird Chinonsos Liebe beschworen, der die "gesellschaftlichen Barrieren" böse im Weg stehen. Dabei ist diese Liebe höchst fragwürdig.
Chinonso kümmert sich wenig um Ndalis Wünsche oder Gefühle, er sieht vor allem sein eigenes Leid – und sie, die er "Mommy" nennt, als seinen Besitz: "Ich habe einen hohen Preis gezahlt, jetzt habe ich sie auch verdient. Und niemand, wirklich niemand kann sie mir wieder nehmen!" Ein wenig zu treuherzig scheint sein Chi sich ihm anzuschließen, seine große Verteidigungsrede basiert auf diesem großen Missverständnis: Ndali sei letztlich schuld an Chinonsos Leid, weil er doch alles nur "ihretwegen" getan habe – vergessend, dass er sich über ihren Willen hinwegsetzte, als er nach Zypern ging.
Der Chi endet mit der gleichnishaften Geschichte eines Mannes, der vom Tod überrascht wird: "Und dabei weiß er nicht, dass alles schon vor langer Zeit geschah und nur geduldig drauf gewartet hat, dass er es merkt." Was völlig ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass hier eine Frau getötet wurde – und zwar nicht vom Schicksal, sondern von einem Menschen. Schicksalhaft ist höchstens, dass Chinonso sie nicht absichtlich ermordet.
Aber er verübt einen Racheakt, der diesen Tod zumindest in Kauf nimmt, und dafür trägt er Verantwortung. Sollte es das sein, was Obioma mit diesem Roman erzählen wollte, so ist ihm das nicht besonders gut gelungen. Eher hat man den Eindruck, hier wird eine recht klassische Beziehungstat als Schicksal verbrämt. (Andrea Heinz, 6.6.2020)