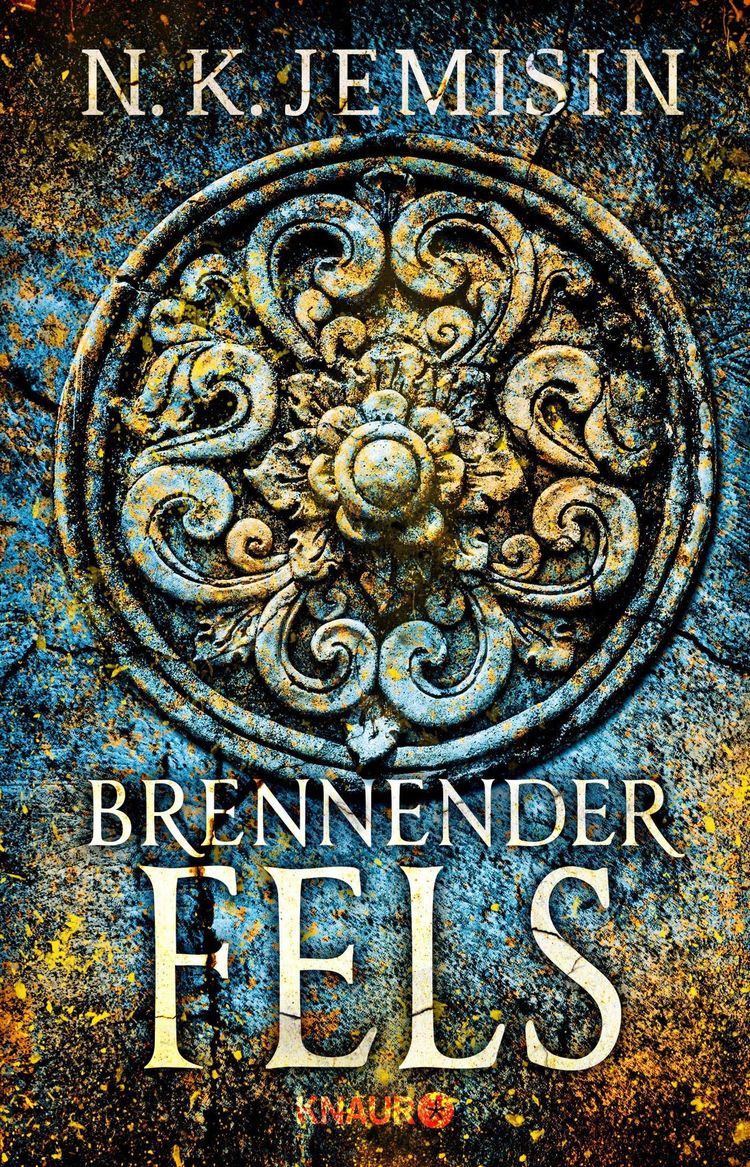
Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die einzigartige Fantasy-Welt, die N. K. Jemisin für ihre Trilogie "Die große Stille" entworfen hat, unsere ferne Zukunft ist. Es ist eine Welt, die alle paar Jahrhunderte von geologischen Katastrophen globalen Ausmaßes heimgesucht wird, genannt Fünftzeiten. Und die Ur-Katastrophe, die das planetare System vor 10.000 Jahren oder mehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dürfte das Verschwinden des Mondes gewesen sein, wie wir in diesem Mittelteil der Trilogie erfahren.
Mittelteile sind meist etwas gefürchtet. Sie können nicht mehr wie Band 1 (in diesem Fall das beeindruckende "Zerrissene Erde") mit der Vorstellung der Welt und dem Reiz des Neuen klotzen. Zugleich dürfen sie aber auch die Handlung noch nicht allzu weit vorantreiben, denn die großen Entscheidungen müssen ja Band 3 vorbehalten bleiben. Jemisin löst das Dilemma recht gut, indem sie uns wohldosierte Einblicke in die Vergangenheit gewährt, ob geologisch, technologisch oder politisch.
Im Boden und am Himmel
Die Gesellschaft der Romangegenwart lebt ja buchstäblich über den fossilen Schichten ungezählter Vorgängerkulturen, und das Erbe dieser Tot-Zivs ist überall zu finden. Einmal wird etwa erwähnt, wie ein Geysir ausbricht, der in Wahrheit einer vergrabenen Rohrleitung entspringt. Je weiter zurückliegend, desto fortgeschrittener scheint die Technologie gewesen zu sein. Bis hin zu den gigantischen Obelisken aus Kristall, die vermeintlich ohne Sinn und Zweck am Himmel schweben.
Das klingt ziemlich nach Science Fiction, und doch ist es Fantasy. Das Schlüsselelement der Trilogie sind nämlich Menschen mit der Gabe, geologische und thermische Prozesse zu beeinflussen, die Orogenen. Sie können Naturkatastrophen abmildern, ebenso oft lösen sie aber selbst welche aus – entsprechend scheel werden sie auch angesehen. Ihre Gabe ist pure Magie, wir haben es also mit einer Welt zu tun, die von einem naturgesetzlichen zu einem magischen Paradigma gewechselt hat. Was in der Fantasy ja nichts komplett Neues ist – denken wir etwa an Terry Brooks' "Shannara"-Zyklus oder die Endzeit-Saga "Dying Earth" von Jack Vance und seinem Nachfolger Matt Hughes.
Die neue Lage
Der Vorgängerband "Zerrissene Erde" ist am Ende seinem Titel gerecht geworden. Ein geologischer Kataklysmus hat eine neue Fünftzeit ausgelöst, die die Welt möglicherweise endgültig verwüsten wird. Asche nieselt vom Himmel und erstickt das Leben, Schwefelgestank hängt in der Luft, tödliche Tiere und Banden von Plünderern machen die Einöde noch gefährlicher. Wer konnte, hat sich in geschützte Gemeinschaften zurückgezogen – wie Hauptfigur Essun, eine Orogene, die im ersten Band unter verschiedenen Namen aufgetreten ist, was eine raffinierte Erzählkonstruktion ergeben hat.
In der Gemeinschaft von Castrima, die das Innere einer riesigen Geode bevölkert, hat Essun mit inneren und äußeren Feinden gleichermaßen zu ringen (Angriffe marodierender Banden und natürlich wieder einmal Streit zwischen Orogenen und Normalsterblichen), zugleich erlangt sie neues Wissen über Vergangenheit und Wesen der Welt. Nebenbemerkung: Dafür, dass es eigentlich ihr oberstes Ziel ist, ihre entführte Tochter Nassun zurückzuholen, hat sie's mit dem Weiterziehen nicht gerade eilig.
Nassuns Vater Jija selbst war es, der sie verschleppt hat. Als er erfuhr, dass seine Kinder Orogenen sind – für ihn eine Abscheulichkeit –, hat er Nassuns Bruder getötet und das Mädchen mit sich nach Süden genommen. Denn dort soll es einen Ort geben, an dem Menschen von dieser Gabe "geheilt" werden können. Vater und Tochter bilden, menschlich betrachtet, die denkbar grauenhafteste Konstellation: "Ich will mein kleines Mädchen zurück." – Ich bin nirgendwo hingegangen, denkt Nassun, aber sie ist klug genug, das nicht zu sagen. Jemisin lässt Jijas Untaten ebenso nachvollziehbar erscheinen wie Nassuns Wunsch, ihre Natur nicht verleugnen zu müssen – leicht gemacht wird es einem hier nicht, eine Seite zu beziehen.
Äußerst dichtgepackte Erzählung
Da sich die zentralen Protagonisten an sicheren Orten einigeln mussten, ist "Brennender Fels" um einiges statischer als der Vorgängerband. Deswegen aber nicht langweilig, dafür ist die Erzählung viel zu dichtgepackt. Jemisin kann gleichermaßen die Wortgewalt eines Mythos entfalten wie Momente größter Intimität schaffen – und beides mit "naturwissenschaftlichen" Anflügen kontrastieren, die wie aus dem Nichts zu kommen scheinen: Er berührt ihren Hinterkopf. Das macht er immer, denn sie mag diese Geste. Als sie ein Säugling war, hat sie lauter gegurrt, wenn er sie dort umfasst hat. Das liegt daran, dass die Mentastzellen in diesem Bereich ihres Hirns liegen und sie ihn – wenn er sie dort berührt – vollständiger wahrnehmen kann.
Und wie schon im ersten Band fragen wir uns, wer denn der anscheinend allwissende Erzähler sein mag, der Nessuns Kapitel in zweiter Person schildert, eine äußerst selten gewählte Form. Den "Aus einer Figur mach drei"-Trick von "Zerrissene Erde" konnte Jemisin hier zwar nicht mehr einsetzen, aber immer noch spielen rätselhaft bleibende Erzählperspektiven eine wichtige Rolle.
Machtverhältnisse
"Brennender Fels" ist letztlich ein Buch über Machtverhältnisse. Auf gesellschaftlicher Ebene, wenn es um die Orogenen geht, die wegen ihrer Gabe instrumentalisiert und in das Korsett eines rigiden Ausbildungssystems gesteckt werden – und trotzdem stets Angst haben müssen, Opfer eines Pogroms zu werden. Aber mindestens genauso wichtig auf individueller Ebene, im Verhältnis zwischen Lehrer(in) und Schüler(in) oder Elternteil und Kind. Es ist übrigens keineswegs so, dass Jija auf die Schurkenrolle reduziert wird und Essun als nahende Retterin herbeigesehnt wird. Nassun hat wenige gute Erinnerungen an ihre Mutter, sie ist ihr vor allem als strenge Zuchtmeisterin im Gedächtnis geblieben.
Täter, Opfer, Retter und Zerstörer – alles ist in allen angelegt. "Die große Stille" ist eine Saga ohne Helden, aber voller Schicksale. Wie diese enden werden, erfahren wir schon bald: Der Abschlussband "Steinerner Himmel" erscheint Anfang Juli.