
Die Probleme von Frauen haben sich kaum verändert, sie fragen etwa noch immer nach ihren Rechten in einer Ehe, sagt Bettina Zehetner.
Die Einrichtung Frauen* beraten Frauen* feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Die Beratungsstelle hat als eine der ersten Einrichtungen schon im Jahr 2006 Onlineberatungen angeboten, die sich mit Ausbruch der Corona-Krise einmal mehr als wichtige Beratungsform erwiesen haben. Das hat nicht nur mit der nun nötigen physischen Distanz auch in Beratungssituationen zu tun, sondern vor allem mit dem Prozess des Schreibens. Bettina Zehetner, Mitarbeiterin bei Frauen* beraten Frauen* und Gründerin der webbasierten Beratungsplattform, spricht darüber, warum Schreiben hilft und Frauen heute stärker die Verantwortung für Probleme bei sich selbst suchen.
STANDARD: Wie hat sich die Onlineberatung in der Corona-Krise entwickelt?
Zehetner: Es hat sich gezeigt, wie wichtig das ist. Wir waren eine der ersten Beratungsstellen, die ein Online-Beratungstool installiert haben – und machen auch Fortbildungen dazu. Die Nachfrage nach Online-Beratung steigt jedes Jahr, die Rückmeldungen sind sehr gut, und wir können eine ganz neue Zielgruppe erreichen, die sich auf einem anderen Weg keine Beratung holen würde.
STANDARD: Wer nimmt dieses Angebot vorwiegend an Anspruch?
Zehetner: Der häufigste Grund, warum sich jemand nicht auf direkterem Weg bei uns melden will, ist Scham und Angst, etwa wenn jemand Gewalt erlebt. Sie denken oft, das müssten sie mit sich selbst ausmachen. Von Gewalt ausübenden Personen gibt es oft auch Druck: "Wehe, du erzählst das jemandem, dann passiert was." Es gibt auch jene Frauen, die wegen Betreuungspflichten plus Job plus auf dem Land lebend und ohne Auto kaum mobil sind. Das macht es schwer, eine Beratungsstelle zu Bürozeiten in ihrer Nähe zu erreichen. Onlineberatung ist auch für transidente Personen, die sich als Frauen identifizieren, wichtig. Sie machen oft enttäuschende Erfahrungen: Sie rufen irgendwo an, werden falsch adressiert, und es werden unangenehme Nachfragen gestellt wie "Sie haben aber eine tiefe Stimme" oder "Sind Sie überhaupt eine Frau?". Sie schreiben uns oft, dass es für sie angenehmer ist, sich schriftlich zu äußern. Eine gute Möglichkeit ist es auch für körperlich eingeschränkte Menschen und jene mit sozialen Ängsten, die nicht sprechen, sondern lieber schreiben wollen.
STANDARD: Geht es neben der logistischen Erleichterung auch um den Prozess des Schreibens selbst?
Zehetner: Ja, das Schreiben selbst ist der Kern der Sache. Gedanken sortieren, formulieren, eine Struktur reinbringen – allein das entlastet. Zudem ist das Dialogische sehr wichtig: Dadurch, dass man zeitversetzt antwortet und sich austauscht, kommt etwas Ruhe rein, wir achten darauf, dass ein angenehmer Rhythmus entsteht. Es ist ein bisschen wie Briefe schreiben, durch diesen Schreibprozess entsteht eine Beziehung. Wir versuchen, die Sprache möglichst Klient*innen-nahe zu halten, Sprachbilder und Formulierungen aufzugreifen, das schafft Nähe.
STANDARD: Hat man erst durch die Erfahrungen gesehen, dass abseits von anderen Vorteilen einer Onlineberatung dieser Schreibprozess so wichtig ist?
Zehetner: Es hat ein paar wenige Studien gegeben, die das bestätigt haben. Wir haben auch schon vor 2006 öfter sehr lange E-Mails bekommen. Doch per E-Mail war das ganz schwer zu handhaben, etwa aus rechtlichen Gründen, Datensicherheitsaspekten, und oft benutzen mehrere Personen denselben Computer. In diesen E-Mails stand oft: "Ich möchte am liebsten nur schreiben." Die Aufforderung, sich telefonisch einen Termin auszumachen, hat praktisch nie zu etwas geführt. Mit unserem Onlinetool, so oft und so lange, wie sie schreiben möchten, konnten wir dieses Bedürfnis erfüllen.

STANDARD: Womit hatten Sie es in der Beratung seit dem Lockdown vorwiegend zu tun?
Zehentner: "Zusammen eingesperrt zu sein", so haben es viele genannt. Corona hat die Probleme sichtbar gemacht, die es ohnehin gab. Enge Wohnungen, schwierige Beziehungen, da eskaliert es in Form von psychischer oder physischer Gewalt enorm leicht. Kontrolle war ein großes Thema, interessanterweise haben Männer nach den Berichten der Frauen stärker versucht, sie zu kontrollieren. Draußen war alles so unsicher, der Job hat gewackelt, da ist Besitzdenken noch viel stärker als vor dem Lockdown zum Problem geworden. Und natürlich war da diese Bürde, Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung zu vereinbaren – und das noch in einer ohnehin belastenden und Angst erzeugenden Situation. Viele Männer haben sich da leider verabschiedet – "Ich mache mein Homeoffice", "Ich habe Wichtiges zu tun" – und haben einfach die Tür hinter sich zugemacht. Die Frauen, die sich bei uns gemeldet haben, haben praktisch nie ein eigenes Zimmer für ihre Arbeit gehabt.
STANDARD: Wie können Sie helfen?
Zehetner: Wenn noch Gesprächsbereitschaft zwischen den Partner*innen da ist, dann versuchen wir bei Überlastungssituationen herauszuarbeiten, wie man die gemeinsamen Aufgaben verteilt. Also nicht ihre, sondern die gemeinsame Arbeit rund um Kinderbetreuung und Haushalt. Wenn jemand aber schon Angst hat, das überhaupt anzusprechen, dann sind natürlich ganz andere Maßnahmen nötig. Man muss gemeinsam überlegen, ob es Rückzugsmöglichkeiten gibt, wo man mal durchatmen kann. Wenn nichts mehr geht, raten wir, sich andere Menschen hinzuzuholen. Freundinnen, Verwandte, Nachbarn, vielleicht auch Institutionen und rund um die Uhr erreichbare Einrichtungen. Als letzte Maßnahme gibt es die Polizei für eine Wegweisung. Wir besprechen dann, ob es Schamgrenzen hin zu diesem Schritt gibt, oder was sie glauben, was dann passiert. Manche haben die Vorstellung, dass die Männer sofort abgeführt und ins Gefängnis gebracht werden, was freilich nicht so ist. Ihnen wird für eine Zeit der Schlüssel abgenommen, da ist noch nichts passiert. Aber während des Lockdowns war das eine große Hürde, weil sich viele fragten, wo die Männer dann hinkönnen.
STANDARD: Was wäre jetzt vonseiten der Politik nötig?
Zehetner: Wichtig wäre eine weitaus bessere Finanzierung der Frauenberatungsstellen. Es ist enorm, was an Beziehungsverbesserungen, an Prävention von Gewalt, von Armut und für den Erhalt der Gesundheit geleistet werden kann. Für all das ist Voraussetzung, dass man langfristige Beratungsprozesse anbieten kann. Wir könnten derzeit jede Stelle fünfmal besetzen, was von unseren Ressourcen her unmöglich ist. Es bräuchte auch grundlegendere feministische Diskussionen: Derzeit gibt es nur Pflaster für die Probleme. "Dann machen wir halt ein paar Kindergartenplätze mehr", versuchen, dieses oder jenes "frauenfreundlicher" zu gestalten. Aber es geht grundsätzlich um die partnerschaftliche Aufteilung während des ganzen Lebens. Und wir sollten mehr darüber sprechen, was vor und nach physischer Gewalt passiert, nicht nur von einem solchen extremen Ereignis an sich. Wir dürfen das, was zu dieser Gewalt führt, nicht im Dunkeln lassen. Zum Beispiel, dass psychische Gewalt ausgeübt wird, das ist leider überhaupt nichts Besonderes. Stärker darauf zu schauen würde das Leben vieler verbessern.
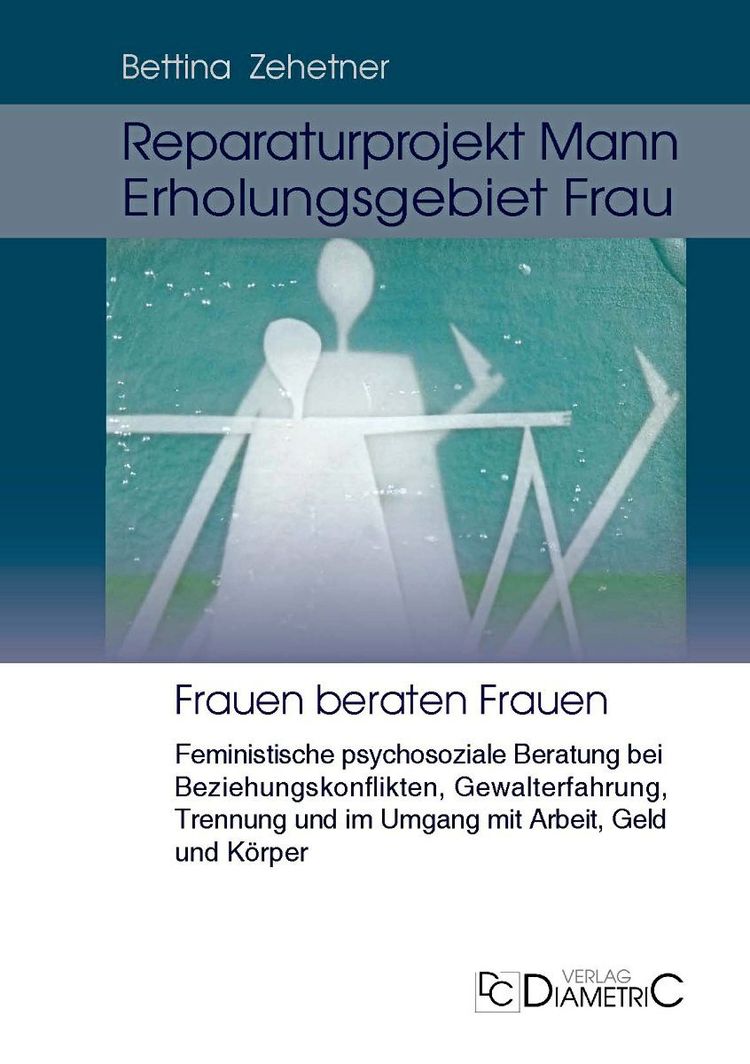
Bettina Zehetner, "Reparaturprojekt Mann – Erholungsgebiet Frau: Feministische psychosoziale Beratung bei Beziehungskonflikten, Gewalterfahrung, Trennung und im Umgang mit Arbeit, Geld und Körper". 18 Euro / 170 Seiten. Diametric-Verlag, 2020
STANDARD: Frauen* beraten Frauen* gibt es seit 40 Jahren. Welche Veränderungen gibt es bei den Problemlagen der Frauen?
Zehetner: Ich habe erst kürzlich mit einer Gründerin von Frauen* beraten Frauen* über diese Frage gesprochen. Sie meinte, die Probleme der Frauen haben sich kaum verändert. Immer wieder kommen Fragen nach ihren Rechten in einer Ehe oder einer Lebensgemeinschaft, wie man sich vor psychischer Gewalt schützen, wie man ein selbstständiges Leben führen kann. Ein Unterschied ist uns aber aufgefallen: Es scheint heute für Frauen fast noch schwieriger zu sein, diese Themen zu bearbeiten, weil alles individualisiert wird. Alles scheint ihre persönliche Schuld zu sein. Das habe ich am Anfang meiner Beratungstätigkeit nicht so erlebt, dieses "Ich mache alles falsch, nichts genügt". Die Leistungsideologie hat sich deutlich verstärkt. Rückblickend haben vor 20 Jahren Frauen eher gesagt, dass es wohl anderen auch so gehen wird, dass die Situation schlimm ist, aber nicht sie daran schuld sind. Das ist erschreckend, und feministische Politik müsste gegen diese Vereinzelung kämpfen – und dass diese Problemlagen als individuelles Versagen gesehen werden.
STANDARD: Wo findet so ein Leistungsdiskurs konkret statt?
Zehetner: Im gesamten Frauenleben. Sie müssen selbstverständlich selbstständig erwerbstätig sein, sich möglichst selbst erhalten, für ihre eigene Pension vorsorgen. Und gleichzeitig lastet immer noch die unbezahlte Sorgearbeit auf Ihnen. Eine Studie hat gezeigt, dass Mütter mit Kindern etwas weniger unbezahlte Arbeit verrichten, wenn der Kindervater nicht bei ihnen wohnt. Das ist eine entsetzliche Aussage, weil sie zeigt, dass Frauen praktisch die Männer mitbetreuen. Hinzu kommen viele andere Anforderungen, etwa schön und fit zu sein. Denken wir nur an die sozialen Medien und diesen Kampf dort, sich gegenseitig das angeblich schönere Leben vorzuzeigen. Dieses "Egal was ich mache, ich genüge nie", das betrifft ganz viele Frauen. Männer sicher auch, aber es geht etwas weniger an den Kern ihrer Identität als bei Frauen. (Beate Hausbichler, 11.9.2020)