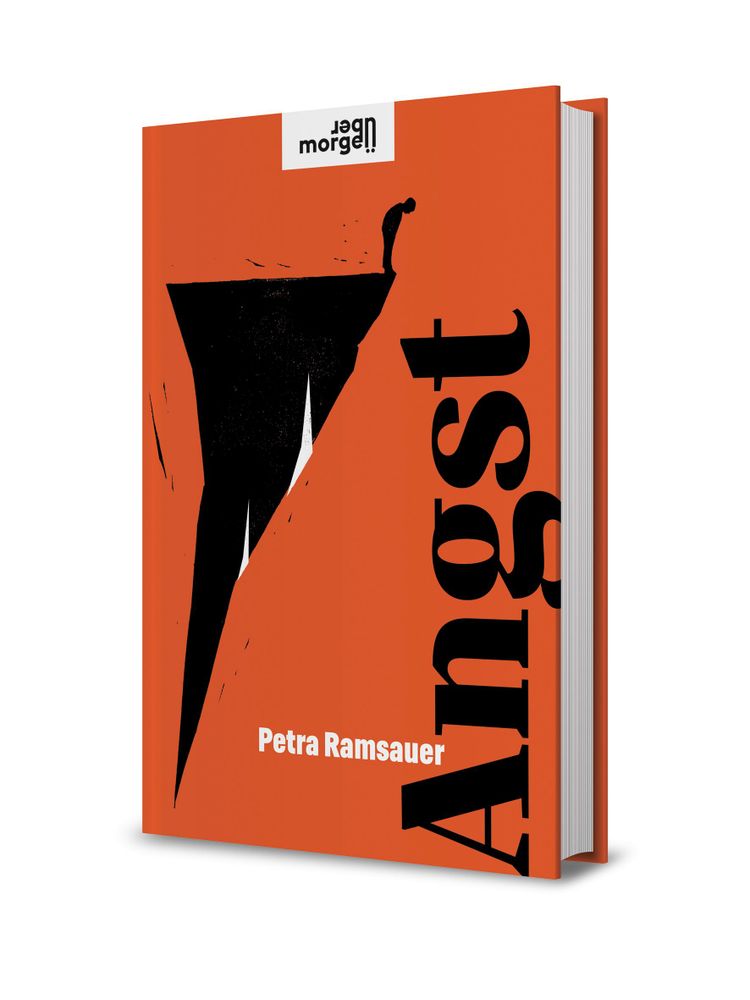Mit Angst kennt sich Petra Ramsauer aus. Im Alter von nur 27 Jahren wurde bei ihr ein Tumor in der Gebärmutter diagnostiziert. Eine Notoperation rettete ihr das Leben. In Lebensgefahr war Ramsauer auch danach noch öfter, reiste die 51-Jährige doch in den letzten 25 Jahren als Journalistin durch zahlreiche Kriegs- und Krisengebiete der Welt. Jetzt ist Schluss damit. Ramsauer kehrt dem Journalismus den Rücken, ihre Erlebnisse reflektiert sie in dem Buch "Angst", das Anfang Oktober bei Kremayr & Scheriau erscheint.
Wenn die Oberösterreicherin ihre Arbeit der vergangenen Jahre Revue passieren lässt, sagt sie: "Ich bin minimal traumatisiert, soweit ich das beurteilen kann. Ich komme in einem Stück aus dem Ganzen heraus. Im Leben kann man es mit dem Glück auch übertreiben."
Kollegen entführt und getötet
Glück hatte Ramsauer nicht nur einmal, erzählt sie im Gespräch mit dem STANDARD. Etwa als der Journalist Steven Sotloff im Jahr 2013 in der Nähe des syrischen Aleppo entführt und später von Mitgliedern der Terrororganisation "Islamischer Staat" ermordet wurde. Sotloff war ebenso wie der bereits ein Jahr zuvor entführte US-Journalist James Foley ein Freund Ramsauers.
Die Journalistin war zum Zeitpunkt von Sotloffs Entführung auch in Aleppo. Sie sei mit einem Auto von der syrischen Stadt zur türkischen Grenze gefahren und habe es dort abgestellt: "Steven hat es von mir übernommen und ist 200 Meter später entführt worden", sagt Ramsauer. "Die Einschläge waren sehr dicht. Sie haben mich auch verändert."
Damoklesschwert Entführung
Die Angst, entführt zu werden, war omnipräsent: "Die schlimmste Vorstellung für mich war, in die Hände von Jihadisten zu kommen." In Libyen und Syrien sei das Risiko "gigantisch groß" gewesen, aber auch im Irak war es nicht zu unterschätzen. Für ihre Reportagen war Ramsauer über 20-mal in dem Kriegsland.
Brandgefährlich war es in der irakischen Hauptstadt Bagdad bereits seit dem Jahr 2005, erzählt sie: "80 Prozent meiner Logistik bestanden darin, nicht entführt zu werden." Sie habe ständig ihre Unterkünfte wechseln müssen: "Man wird ja nicht vom IS entführt, sondern von Kriminellen, die einen an die Terroristen weiterverkaufen."
Sicherheitsstandards
Und die versuchen wiederum, Lösegeld zu lukrieren, oder sie schlachten die Journalisten einfach ab. Foleys und Sotloffs Enthauptung wurde gefilmt und als Propagandamaterial verwendet. Solche Szenen haben nicht nur ihre Psyche verändert, sondern auch die Arbeit als Journalistin: "Ich muss vor Ort einen wesentlich höheren Sicherheitslevel anlegen." Etwa wenn es um die Fahrer und Fixer ging, die sie anheuern musste. Also jene lokalen Medienakteure, die als Guides oder Dolmetscher fungieren und Journalisten über Checkpoints bringen: "Wir reden da von Milizen und nicht von staatlichen Strukturen, die Bewilligungen ausstellen."
Die Reise- und Spesenkosten seien regelrecht explodiert: "Ich musste in letzter Zeit zwei Autos nehmen, weil ich nicht riskieren konnte, dass eines streikt und ich nicht mehr wegkomme." Das summiere sich auf hunderte Euro pro Tag, sagt Ramsauer und nennt ein Beispiel. Sie sei in den letzten Jahren immer wieder in Libyen gewesen, um über die Internierungslager zu berichten. "Zum Schluss hat mir aber die Dollar-Power gefehlt, weil dort Anarchie herrscht. Wir reden hier von Kosten um die 1.500 Euro pro Tag." Medien seien nicht bereit, das zu zahlen.
Qualitätsanspruch bleibt
Eine ordentliche Geschichte in Libyen koste die freie Journalistin 10.000 Euro. Libyen sei zwar ein Extrembeispiel, aber auch in anderen Gegenden der Welt brauche sie für ihre Reportagen 3.000 oder 4.000 Euro. Ihren Qualitätsanspruch möchte sie nicht nivellieren: "Mein Anspruch ist, dass jede Geschichte so gut ist, dass sie im 'Spiegel' erscheinen könnte", sagt Ramsauser: "Egal ob ich jetzt 100 oder 1.000 Euro dafür bekomme." Ein renommiertes deutsches Medium hat ihr beispielsweise 150 Euro für eine Geschichte geboten: "Ich habe abgelehnt. Das geht sich nicht mehr aus."
Strapazen
Immer niedriger werdende Honorare bei davongaloppierenden Kosten: Die Rechnung geht sich für Ramsauer nicht mehr aus. "Ich bin nicht mehr bereit, diese mangelnde Bereitschaft des journalistischen Systems, in diese wichtigen Reisen zu investieren, mit meiner Lebensqualität und meiner Gesundheit auszugleichen", sagt sie. In den letzten sechs Jahren habe sie keinen Urlaub gemacht, die Strapazen der Kriegsberichterstattung manifestieren sich mittlerweile auch körperlich. "Ich habe sehr viele Darminfektionen gehabt, etwa Cholera und Ruhr, und ich vertrage nicht mehr alles beim Essen."
Dazu kommen Probleme mit der Schulter und den Knien. Alles Folgen der schweren Schutzausrüstung: Die kugelsichere Jacke mit den harten Platten habe insgesamt 30 Kilo – bei einem Körpergewicht von 56 Kilo.
Fördertopf für Journalismus
In den vergangenen 22 Jahren arbeitete Ramsauer als freie Journalistin, zuletzt erschienen ihre Reportagen regelmäßig in der "NZZ am Sonntag" und im "Profil". Zuvor war sie beim ORF, "Kurier" und zehn Jahre beim Nachrichtenmagazin "News", wo sie auch das Auslandsressort leitete. Ramsauer erzählt von beinahe paradiesischen Zuständen, die bei "News" in ihren Anfangsjahren Ende der 90er-Jahren geherrscht hätten: "Allein in der Außenpolitik waren wir acht Leute, und ich habe pro Jahr Reisen im Wert von 60.000 oder 70.000 Euro gemacht", sagt Ramsauer und lacht: "Und ich war auch noch die Billigste."
Um die wichtige Arbeit von freien Journalisten zu finanzieren, wünscht sich Ramsauer, dass ein Teil der Presseförderung in einen eigenen Topf für Reportagen fließt und in Form einer Stiftung verwaltet wird – zum Beispiel vom Presseclub Concordia.
Fakten statt Gefühle
Die Presseförderung ist derzeit mit neun Millionen Euro pro Jahr dotiert: würde nur ein Prozent davon umgeleitet, ließen sich schon ein paar Auslandsreisen organisieren. Dabei gehe es nicht nur um den Journalismus im Speziellen, sondern um Demokratie im Allgemeinen: "Man muss dagegenhalten, wenn Politiker sagen: 'Wir machen lieber Hilfe vor Ort'", sagt Ramsauer und meint das Thema Flüchtlinge: "Ich muss vor Ort sein, um das beurteilen zu können." Gerade in der Außenpolitik ortet sie einen "Austausch von Gefühlen. Ich bin altmodisch und habe immer noch gerne Fakten."
Nie mehr vergessen wird Ramsauer, was sie bei ihren Aufenthalten in der syrischen Bürgerkriegsstadt Aleppo erlebt hat. Jede Sekunde konnten Fassbomben einschlagen, schildert sie den grausamen Luftkrieg: "Es gab schwarze Zonen in Spitälern, wo es keine Medikamente mehr gab. Kinder und Erwachsene wurden zum Sterben hingebracht." Um den Schmerz von Verbrennungen zu lindern, wurde Lehm verwendet, weil es keine Medikamente mehr gab: "Das waren Momente, die werde ich nie mehr vergessen. Diese Zeit in Syrien hängt mir nach." Weil sie vielfach aufseiten der Opposition berichtet habe, stehe sie auf der schwarzen Liste des syrischen Regimes.
Image versus Realität
Glamourös sei der Job als Kriegsreporterin selten, sagt Ramsauer: "Er ist mehr wie ein wildes Pferd, das einen abwirft." Sie würde sich auch nicht als Kriegsreporterin, sondern lieber als Konflikt- und Krisenreporterin bezeichnen, denn: "Kriegsreporter hat das Image des Hartgesottenen – so als würden wir vom Krieg leben und diese Angstlust befeuern." Für sie und die meisten ihrer Kollegen stimme das nicht: "Ich habe keine Angstlust und finde es nicht super, bombardiert zu werden." Glorifizieren brauche man hier nichts: "Mein Job ist es aufzuzeigen, wo Menschenrechtsverbrechen passieren."
Was sie mit ihren Reportagen und dem Motto "Erzählen, was ist" bewirkt habe, könne sie schwer beurteilen, aber: "Ganz konkret verändert habe ich das Leben der Tochter von einem meiner wichtigsten Fahrer im Irak." Über die vielen Jahre habe sie engen Kontakt mit seiner Familie gehabt und sei zu einem Vorbild avanciert: "Für die Tochter war ich das Role-Model, dass man als Frau nicht heiraten und Kinder kriegen muss, sondern ein freies Leben führen kann." Der Vater habe seiner Tochter schließlich das Studium ermöglicht.
"In jedes Drecksloch gesetzt"
Es sei ihr immer wichtig gewesen, zuzuhören und den vielen Kriegsopfern eine Stimme zu geben: "Ich habe mich 20 Jahre in jedes Drecksloch gesetzt und den Menschen das Gefühl gegeben, dass man sie nicht allein in ihrem Drecksloch sitzen lässt, sondern sich die Mühe macht, dort hinzufahren", sagt Ramsauer. Und: "Auch wenn das gar nichts nutzt und sie sich deswegen keine Wurstsemmel kaufen können, es geht auch darum, den Menschen diese Würde wiederzugeben. Dass das Unglaubliche, das sie aushalten müssen, nicht allen völlig egal ist, sondern dass es Menschen gibt, die wissen wollen, wie es ihnen wirklich geht."
Statt Journalismus macht die Oberösterreicherin jetzt eine Ausbildung zur Therapeutin – mit dem Fokus Traumata. An potenziellen Klienten mangelt es nicht. Vielleicht schließt sich auch der Kreis, denn Ramsauer kann sich vorstellen, als Therapeutin und Trauma-Expertin beispielsweise wieder im Nahen Osten zu arbeiten: "Mit dem neuen Job könnte ich wieder dort sein, mit dem Journalismus nicht." (Oliver Mark, 26.9.2020)