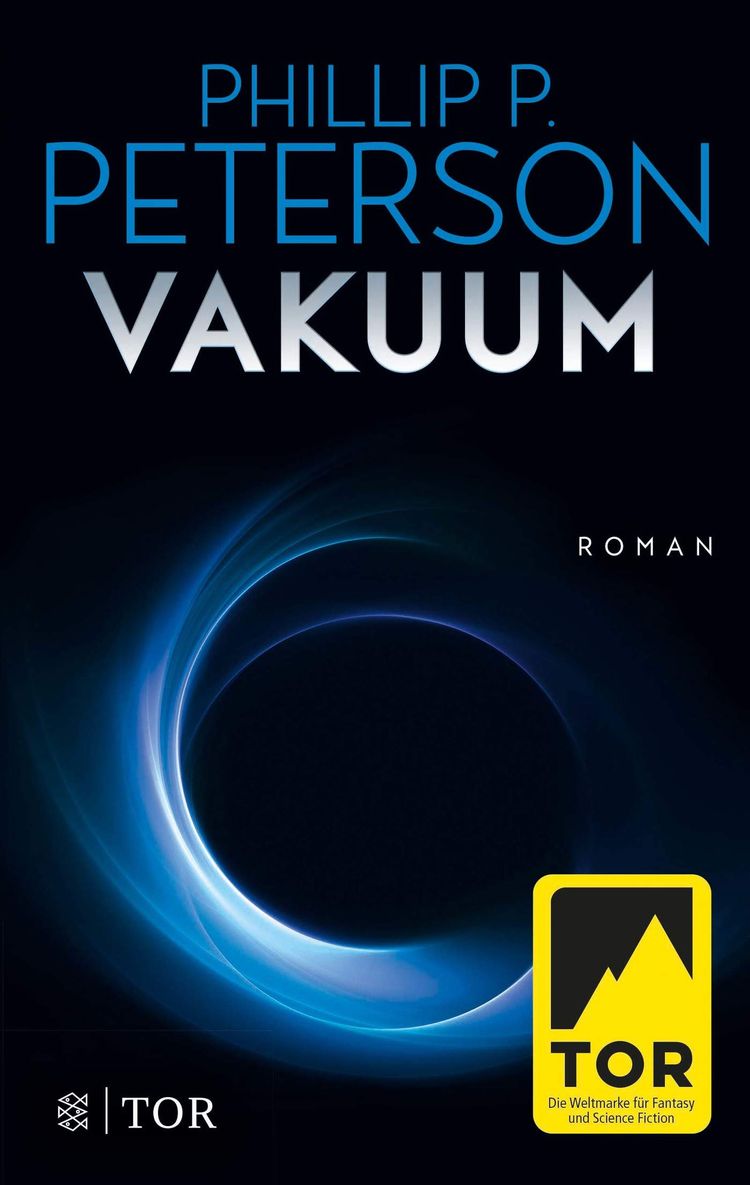
2007 veröffentlichte Stephen Baxter die wunderbare, wenn auch traurige Kurzgeschichte "Last Contact", in der die Sterne zu erlöschen beginnen. An die fühlte ich mich sofort erinnert, als sich das Szenario von Phillip P. Petersons "Vakuum" herauszuschälen begann – "der endgültigste Katastrophenthriller, der je geschrieben wurde", wie Andreas Eschbach in einem Blurb verheißt. Doch wenn ich mir seinerzeit auch gedacht habe, was für einen fantastischen Roman die Idee hinter "Last Contact" ergeben würde – "Vakuum" ist nicht dieser Roman geworden.
Das Ende naht
Ende der 2020er Jahre registriert man auf der Amundsen-Scott-Südpolstation ein stark erhöhtes Neutrino-Aufkommen aus Richtung der Hyaden. Das spräche dafür, dass es in dem Sternhaufen zu einer Supernovaexplosion gekommen ist, doch lässt sich weit und breit keine ausmachen. Stattdessen verschwindet sang- und klanglos ein erster Stern, als hätte man eine Glühbirne ausgemacht; es wird nicht der letzte bleiben. Die leitende Wissenschafterin der Station ist eine der Hauptfiguren des Romans, eine Physikerin namens ... Susan Boyle. (Ernsthaft? Warum nicht gleich Helene Fischer? Wie auch immer sie danach beschrieben wurde, mein Bild im Kopf war damit einzementiert).
Die zweite Hauptfigur, der Astronaut Colin Curtis, setzt gerade zur Mondlandung an, als er im letzten Moment zurückgepfiffen wird, weil die NASA alle Ressourcen auf ein neues Projekt umleiten muss: Ein vermeintlicher Komet, der gerade erst entdeckt wurde, entpuppt sich nämlich als außerirdisches Raumschiff, das ohne haltzumachen durchs Sonnensystem rasen wird. Hätten die nicht noch zwei Tage warten können?, ärgert sich Collins – doch wie wir bald sehen werden, ist die Antwort darauf das entschiedenste Nein aller Zeiten. Denn das Alien-Schiff übermittelt im Vorbeiflug noch rasch ein paar quantenphysikalische Formeln, aus denen sich nur ein Schluss ziehen lässt: Das Ende naht. Das Ende von ALLEM. Susan und Colin werden nun zu leitenden Mitarbeitern eines Projekts, mit dem die USA retten wollen, was vielleicht noch zu retten ist – koste es, was es wolle.
Die Baxter-Formel
Der als Philip P. Peterson schreibende Peter Bourauel ist offenbar Teil einer neuen Strategie bei Fischer Tor, erfolgreichen deutschsprachigen Selfpublishing-Autoren ein verlegerisches Dach anzubieten. Martin Langner alias Thariot machte vor einem Jahr den Anfang, mit Peterson geht's heuer weiter, und für 2021 ist mit Benjamin Krämer aka Joshua Tree schon der nächste angekündigt.
In diesem Ensemble steht Peterson für Hard SF, und speziell "Vakuum" ist ganz auf das Segment der Stephen-Baxter-Leserschaft zugeschnitten. Das Fundament bildet ein physikalisches Theorem, aus dem ein "Was wäre, wenn es wirklich dazu käme ..."-Plot abgeleitet wird. Dazu gesellen sich ein Konzept aus der Raumfahrtgeschichte (hier: das Orion-Programm) und ein durchgängiger Fokus auf technische Abläufe; dank Petersons Ausbildung zum Luft- und Raumfahrtingenieur kommt das auch glaubhaft rüber. Zu guter Letzt teilt Peterson auch Baxters Zwangoptimismus, dass es immer irgendwie weitergehen muss, selbst wenn das ganze Universum in Klump fällt. Egal, wie groß die Bedrohung auch ist, ein wissenschaftlicher Kraftakt kann die Rettung bringen: "Was wird es kosten?" – "Alles."
Wenn sich ein Autor selber spoilert
Ich habe mir absichtlich verkniffen, das exakte Wesen der Bedrohung anzusprechen. Obwohl es schon sehr früh im Roman genannt wird, deutlich diesseits der normalen Spoilergrenze eigentlich. Aber ich will "Vakuum" wenigstens irgendein Geheimnis lassen, wenn es schon Peterson selbst nicht tut. Er hat nämlich die für mich nicht nachvollziehbare Entscheidung getroffen, einen dritten Handlungsstrang einzuflechten, der viel zu viel verrät. Da lernen wir Pala und Toma kennen, zwei junge Bewohner einer offensichtlich künstlichen Welt. Doch auch wenn sie nur noch über das Wissen steinzeitlicher Bauern verfügen, ist sonnenklar, dass es sich bei ihnen nur um die Nachfahren derer handeln kann, die gerettet wurden. Wir wissen also von Anfang des Romans an, dass das Projekt letztlich funktionieren wird. Und damit ist ein Großteil der Spannung im Haupthandlungsstrang zwangsläufig dahin.
Offen bleiben höchstens noch Details – zum Beispiel die Frage, ob auch unsere Protagonisten aus dem Haupterzählstrang zu den Geretteten zählen werden. Womit wir aber schon mitten in den Aspekt Human Drama hineinsegeln, der in aller Regel nicht die Stärke von Hard SF im Allgemeinen ist, nicht die von Stephen Baxter im Speziellen und – zumindest wenn man nach "Vakuum" geht – wohl auch nicht die von Phillip P. Peterson. Mit einer Ausnahme: Colin wandelt sich im Verlauf des Romans in ebenso schöner wie schön beschriebener Weise vom egoistischen Womanizer zu einem nachdenklichen und mitfühlenden Menschen. Das ist gut gedacht und auch gemacht, der Großteil der Figuren bleibt aber auf die jeweilige Funktion für den Plot beschränkt.
Unterspielt
Ansätze für etwas mehr Tiefgang waren vorhanden, wie eine scheinbar unbedeutende Episode am Rande zeigt, die im Konzeptstadium des Romans vielleicht noch eine größere Rolle spielte als in der tatsächlichen Ausführung: Susan besucht ihre Alzheimer-kranke Mutter im Spital, die an lebenserhaltenden Maschinen hängt und laut Prognose der Ärzte längst tot sein müsste. Aber irgendwie krallt sie sich immer noch am Leben fest. Wenn sich Susan nun fragt, warum ihre Mutter nicht loslassen kann, dann ist das letztlich dieselbe Frage, vor der im Roman die Menschheit als Ganzes steht: Welchen Sinn hat es, sich zusätzliche Zeit zu erkaufen, wenn das Ende ja doch von vorneherein feststeht? "Vakuum" ist aber kein philosophischer Roman, und so nimmt diese Episode im Buch kaum mehr Platz ein als hier in der Rezension. Man bemerkt den Gedanken dahinter stärker als das Gefühl, das er hervorrufen wollte.
Das heißt übrigens nicht, dass ich unbedingt eine Meditation über den Sinn des Lebens und die Unausweichlichkeit des Todes lesen wollte. Eine spannende Ereignisbeschreibung reicht mir bei einem SF-Roman oft voll und ganz. Aber wenn ein Autor die Spannung durch einen Vorgriff auf die Zukunft untergräbt ... ja, dann braucht es irgendeinen Faktor, der diesen Verlust wieder ausgleicht. Den finde ich hier aber nicht. "Vakuum" zu lesen ist kein schlechter Zeitvertreib. Es fühlt sich nur irgendwie so an, als würde man sich im Sonntagnachmittagsprogramm die Wiederholung eines Fußballspiels ansehen, dessen Ausgang man bereits kennt.