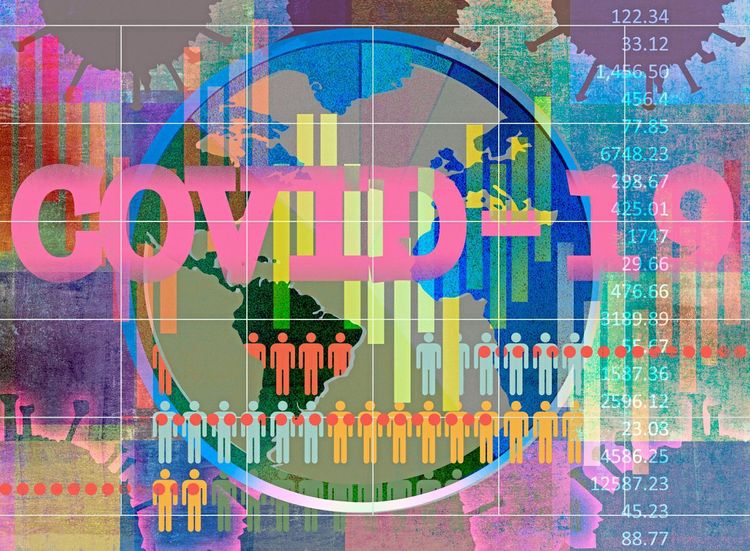
Statistiken prägen weltweit den Umgang mit Covid-19. Doch welche Daten verfügbar sind, ist höchst unterschiedlich.
Nicht erst seit Corona ist der eingeschränkte Zugang zu Daten der Verwaltung und der amtlichen Statistik in Österreich für die Wissenschaft ein Problem. Mitten in der Pandemie zeigt sich umso deutlicher, wie essenziell Daten sind, um politische Entscheidungen aufgrund wissenschaftlicher Evidenz treffen und transparent kommunizieren zu können. Immer wieder fordern Experten eine solide Datenbasis für die Forschung, darunter auch die Plattform Registerforschung, ein Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen sowie Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Eine von ihnen ist Katja Mayer, Open-Science-Expertin am Zentrum für Soziale Innovation (ZSI).
STANDARD: Seit dem Ausbruch der Pandemie sind Daten so schnell verfügbar wie noch nie, andererseits wird oft mangelnde Transparenz kritisiert, was die Datengrundlage für politische Maßnahmen betrifft. Was hat sich denn durch Corona verändert in Sachen Open Science?
Mayer: Durch die Pandemie sind Problemlagen, auf die schon seit vielen Jahren hingewiesen wird, sichtbarer geworden. Sie hat für die Gesellschaft greifbarer gemacht, wie wichtig Open Science ist. Man muss allerdings unterscheiden: Biomedizinische Daten, wie etwa genetische Codes des Sars-CoV-2-Virus, werden relativ schnell geteilt. Hier gibt es schon gute Infrastrukturen und internationale Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite ist die Datenlage im Public-Health-Sektor sowie im Sozial- und Wirtschaftsbereich problematisch. Hier gibt es viele beteiligte Akteure auf Länder- und Bundesebene, allein innerhalb österreichischer Grenzen. Daten werden ganz unterschiedlich erzeugt und gehandhabt.
STANDARD: Was genau ist das Problem?
Mayer: Man hat in den letzten Jahren verabsäumt, sowohl Infrastrukturen als auch Governance-Strategien zu schaffen, die in Krisenzeiten greifen. Man wurde überrumpelt. Jetzt kann man nur versuchen, Feuer zu löschen. Allein wie unterschiedlich die Institutionen Daten in größere Systeme einpflegen, war bisher nicht genau geregelt und war auch in dieser Schnelligkeit bisher nie nötig. Es ist natürlich schwierig, innerhalb eines halben Jahres alles neu aufzustellen, aber es wäre sehr wichtig, jetzt die Weichen zu stellen, um in Zukunft bessere und robuste Schnittstellen zu schaffen. In Krisen sind nicht nur Zugänge zu Gesundheitsdaten und biomedizinischer Forschung wichtig, sondern auch Zugänge zu Wissen über öffentliches Leben, Arbeitsmarkt, Bildung, Umwelt und Wirtschaft. Wenn wir offen und evidenzbasiert agieren wollen, müssen wir wissen, mit welchen Daten wir es zu tun haben und auf welche wir uns verlassen.

STANDARD: Die Frage, inwieweit Schulen das Infektionsgeschehen beeinflussen, war ja zuletzt höchst umstritten.
Mayer: Die Diskussion um Schulschließungen ist ein Paradefall. Die wissenschaftliche Forschung dazu ist bisher nicht schlüssig. Es gibt zwar erste Studien zur Altersverteilung bei Infektionen in Schulen, die das Testverhalten miteinberechnen, also zeigen, was eigentlich abgebildet wird in den Studien und ob es tatsächlich Effekte gibt. Aber diese Daten sind selten zugänglich. Neben den fehlenden Infrastrukturen fehlen uns hier Mechanismen, um auch sensible Daten für die unabhängige Forschung zugänglich zu machen, und zwar ohne den Datenschutz zu verletzen. Entscheidungen einer Kommission, wer welchen Zugang zu welchen Daten erhält, sollten zudem transparent dokumentiert werden.
STANDARD: Wie könnte der Zugang zu sensiblen Daten für die Forschung funktionieren?
Mayer: Da gibt es verschiedene Modelle. Es geht nicht darum, alle Daten vollständig für alle offenzulegen oder dass Wissenschafter die Daten aus den Systemen saugen, sondern dass umgekehrt Forschende zu den Behörden und Agenturen hinkommen, wo sie ihre Methoden auf deren Servern laufen lassen können. Im Regierungsprogramm ist der Aufbau eines "Austrian Micro Data Center" vereinbart, das vom Wissenschaftsministerium umgesetzt werden soll. Hier geht es genau darum, dass die akkreditierte, unabhängige Wissenschaft Zugriff auf Registerdaten bekommt, also Daten aus öffentlichen Registern der Ministerien und amtlichen Statistiken. Auch von den Daten der Telekomprovider könnte man über eine Pandemie viel lernen.
STANDARD: An welchen Daten fehlt es konkret?
Mayer: Es geht vor allem um sozioökonomische Daten, zum Beispiel alles rund um die Auswirkungen von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Das fängt schon damit an, dass wir nicht wissen, welche Branchen welche Beträge aus den Corona-Unterstützungsfonds bekommen haben, bis hin zu Gesundheitsdaten von den Sozialversicherungen, etwa zu Frequenz und Arten von Arztbesuchen während eines Lockdowns. Es ist sehr schwierig, Aussagen und Prognosen über eine Pandemie zu machen und immer wieder zu adaptieren, wenn man keinen Zugriff auf solche essenziellen Daten hat.
STANDARD: Gibt es Beispiele, wo das Corona-Datenmanagement besser funktioniert?
Mayer: Was noch nirgends funktioniert, sind automatische Schnittstellen, hier lernen alle noch. Aber es gibt eine wesentlich großzügigere Handhabung des Zugangs für die unabhängige Forschung in einigen Ländern, wie etwa in Großbritannien. Auch Dänemark gilt als Vorreiter, wo viele Register und auch Sozialversicherungsdaten für die Forschung freigegeben sind. Natürlich gab es anfangs in diesen Ländern auch Pannen und Datenlecks, aber man hat daraus gelernt, und die Infrastrukturen sind nun wesentlich sicherer.
STANDARD: Wäre nicht eine zumindest EU-weite Datenharmonisierung in Bezug auf Corona wünschenswert?
Mayer: Ja, unbedingt. Doch das ist sehr schwierg. In der Medizin wird an dem Ziel der Heilung gearbeitet, aber in der sozioökonomischen-politischen Welt gibt es sehr viele verschiedene Ziele. Es wäre dennoch wichtig, gewisse Indikatoren zu Standardisieren, und zwar so rasch wie möglich. Man könnte sich etwa auf einheitliche Daten zu Übersterblichkeit und Testpositivitätsraten einigen und im Sinne einer Informationsoffenlegungspflicht verlangen, dass Altersstrukturen mitveröffentlicht werden. Da könnte von der EU wesentlich mehr Druck gemacht werden. Wir sehen dazu auch erste Bemühungen.
STANDARD: Sind Sie zuversichtlich, dass es zu einem Umschwung in Richtung mehr Datenoffenheit und Transparenz geben wird?
Mayer: Die Tendenz geht in diese Richtung, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich glaube, dass viele Staaten verstanden haben, dass es unabhängige, nichtprofitorientierte Dateninstitutionen braucht. Es gibt ein Umdenken in der Politik, dass es sich hier um kritische Infrastrukturen handelt, die hochsensibel sind. Es wird in den nächsten Jahren auch mehr Forschungsgelder für die Verbindung von Computer-, Rechts- und Sozialwissenschaften geben, Stichwort digitaler Humanismus. Dass Daten jeder Art zugänglich gemacht werden müssen, ist jetzt noch klarer geworden. Andererseits muss immer die Gefahr einer totalen Überwachung berücksichtigt werden. Indem man Daten Standardisiert und zusammenführt, schafft man auch ein unglaublich starkes Kontrollinstrumentarium. Gerade deswegen ist es wichtig, dass hier übergeordnete Gremien transparente Entscheidungen treffen. Politik und Gesellschaft müssen lernen, mit dieser Offenheit gewissenhaft umzugehen. (Karin Krichmayr, 26.11.2020)