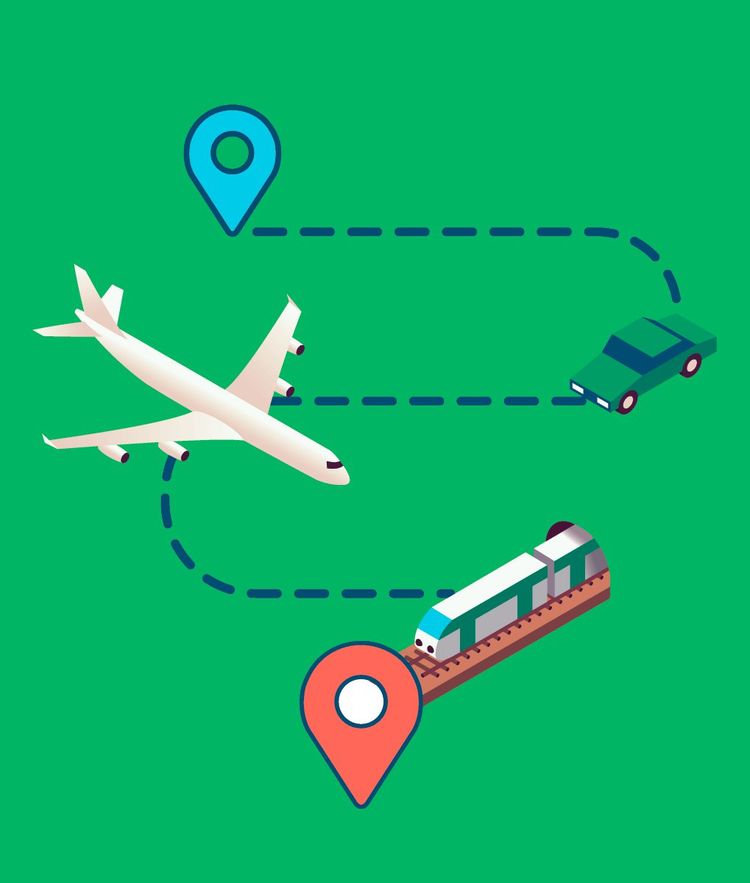
Bei der politischen Umsetzung der ökologischen Steuerreform gibt es allerdings noch zahlreiche Hindernisse.
Vor kurzem haben Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die Pläne der seit Dienstag 42-Jährigen für eine ökosoziale Steuerreform konkretisiert. Die Tendenz ist klar: Der Flugverkehr und der Straßenverkehr – aufgrund steigender CO2-Emissionen Sorgenkinder der klimapolitischen Ambitionen – sollen belastet, der Rad- und der Schienenverkehr entlastet werden.
Das sind erste Schritte. Aus umwelt- und wettbewerbsrechtlicher Sicht ist allerdings eine viel weitergehende Bepreisung von Treibhausgasen und anderen Umweltbelastungen angezeigt.
"Was nichts kostet, ist nichts wert": Dieser – Albert Einstein zugeschriebene – Aphorismus beschreibt auf subtile Weise den Gedanken, der hinter der Ökologisierung von Abgabensystemen steckt. Solange Umweltgütern keine Preise zugeordnet werden, neigt der Homo oeconomicus zur Übernutzung, was wiederum zu einer Verknappung der Ressourcen führt.
Der Verschmutzer zieht Profit aus seinem umweltschädlichen Verhalten, die Allgemeinheit trägt die Belastung. Dass dieses Ergebnis nicht nur wohlfahrtökonomisch, sondern auch aus grundsätzlichen Gerechtigkeitserwägungen suboptimal ist, leuchtet ein.
Und dennoch ist das bestehende Steuer- und Abgabensystem – mit wenigen Ausnahmen – nicht darauf ausgerichtet, Umweltbeeinträchtigungen als sogenannte externe Effekte beim Verursacher kostenseitig zu internalisieren – mit handfesten Folgen für den Wettbewerb.
Flug- vs. Bahnverkehr
Ein plakatives Beispiel für die ungleiche abgabenseitige Belastung von miteinander konkurrierenden Dienstleistungen hat die erste österreichische Klimaklage zum Thema gemacht. Greenpeace und 8062 (!) weitere Antragsteller und Antragstellerinnen haben die Steuerbefreiung für Kerosin nach dem Mineralölsteuergesetz und die Bevorzugung internationaler Flüge bei der Umsatzsteuer beim Verfassungsgerichtshof bekämpft.
Als Bahnfahrer seien sie direkt von der steuerlichen Schlechterstellung des klimaschonenden Schienenverkehrs gegenüber dem klimaschädlichen Flugverkehr betroffen. Aus grundrechtlichen Erwägungen sei die gesetzliche Ungleichbehandlung verfassungswidrig.
Der Erfolg blieb der Klimaklage verwehrt: Der Verfassungsgerichtshof hat das Begehren aus formalen Gründen für unzulässig erachtet, zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung kam es nicht.
Polluter pays principle
Dabei hat die Klage den Finger durchaus in eine offene Wunde gelegt. Gerade im Flugverkehr war vor dem pandemiebedingten Knick die jährliche Zunahme der Treibhausgasemissionen galoppierend.
Gleichzeitig sind – trotz jüngster Nachjustierungen mittels Flugticketabgabe – Mittelstreckenflüge zu Preisen erhältlich, zu denen man mit der ÖBB (wenn überhaupt) bis zur Staatsgrenze kommt. Der gewünschte Umstieg auf die Schiene wird unter solchen Marktbedingungen kaum gelingen.
Was viele übersehen: Die steuerliche Verschonung klimaschädlicher Verhaltensweisen ist auch rechtlich problematisch. Das Verursacherprinzip – eine der tragenden Säulen der europäischen Umweltpolitik (Artikel 191 AEUV) und damit auch Richtschnur der nationalen Abgabengestaltung – erfordert eine verursachergerechte Kostenanlastung. Treffend die englische Bezeichnung: polluter pays principle – wer verschmutzt, soll zahlen.
Ziel ist es, Kostwahrheit herzustellen, womit ein wirtschaftlicher Anreiz einhergeht, die Umweltbeeinträchtigung zu reduzieren (etwa durch einen Umstieg auf sauberere Technologien oder Verkehrsmittel). Gleichzeitig werden Einnahmen zur Beseitigung der entstandenen Schäden lukriert. Das impliziert, dass wirtschaftliche Tätigkeiten, die ohne verursachergerechte Kostenanlastung verschmutzen dürfen, nicht auch noch mit Staatsbeihilfen belohnt werden sollen.
Föderungen für fossile Energieträger
So zumindest die naheliegende Theorie. Die Praxis ist freilich eine andere: Fossile Energieträger profitieren – allen ambitionierten Klimazielen zum Trotz – praktisch unverändert von staatlichen Subventionen. Ihr Abbau wird zwar regelmäßig von der EU-Kommission gefordert und von der Regierung in Aussicht gestellt. Doch die angekündigte "schwarze Liste" der ökologisch abträglichen Förderungen lässt auf sich warten.
Eine ökologische Steuerreform verlangt auch das Schlachten so mancher heiligen Kuh. Die ersten Ankündigungen des grünen Koalitionspartners – Ausrichtung der NoVA an der CO2-Bilanz der Fahrzeuge, steuerliche Boni für den öffentlichen Verkehr – haben die richtig heißen Eisen noch unberührt gelassen.
Gespannt darf man sein, ob es gelingen wird, den gordischen Knoten Dieselprivileg zu zerschlagen. Die Fronten scheinen hier verhärtet, obwohl das Regierungsprogramm mit der "schrittweisen Herstellung von Kostenwahrheit bei den CO2-Emissionen" einen klaren Auftrag erteilt. Die Ausrichtung des Abgabenwesens am Verursacherprinzip muss nicht zwingend mit einer Erhöhung der Gesamtsteuerbelastung einhergehen.
Zankapfel Dieselprivileg
Wichtig ist, dass die Anreize richtig gesetzt werden: Eine Abschaffung des Dieselprivilegs kann durch zielgerichtete Förderungen auf anderer Ebene kompensiert werden. Am Ende des Tages soll sich umweltschonendes Verhalten auszahlen.
Dass Lenkungseffekte allerdings dort ihre Grenzen finden, wo keine tauglichen Alternativen – etwa zur Nutzung des Pkws – bestehen, wird bei der ebenfalls diskutierten Neugestaltung der Pendlerpauschale deutlich.
Hier gilt es neben den ökologischen auch soziale Aspekte zu berücksichtigen – eine Lehre, die aus der französischen Gelbwestenbewegung, deren Initialzündung ja eine geplante Erhöhung der Besteuerung fossiler Kraftstoffe war, gezogen werden sollte. Eine einkommensgerechte Staffelung, ein stärkeres Abstellen auf die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die Besserstellung klimafreundlicher Transportmittel wären mögliche Schritte hin zu einem ökologischeren und verursachergerechteren Pendeln.
Das ist nicht nur gesamtökonomisch schlau, sondern – wie die Ökologisierung des Steuersystems an sich – auch eine rechtliche Notwendigkeit. Bleibt nur die Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann? (Florian Stangl, 4.12.2020)