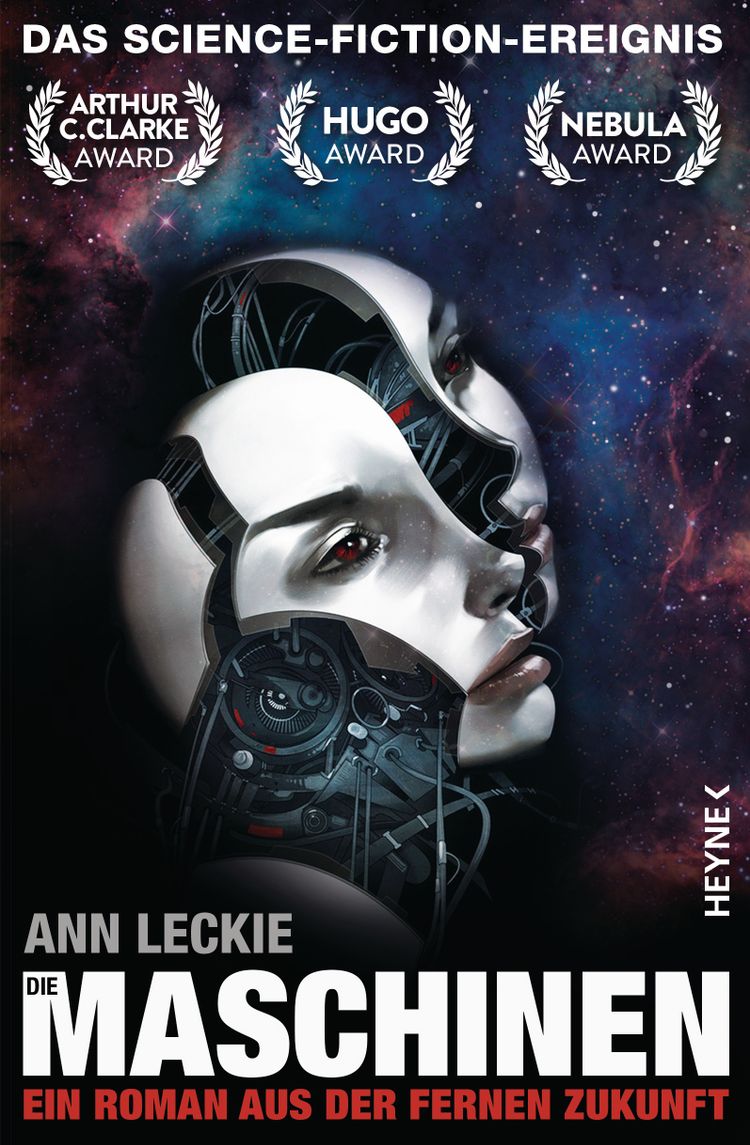
[Anmerkung: Diese Rezension ist ursprünglich im Jahr 2015 erschienen.]
All die Lorbeerkränze auf dem Cover, das sieht ja aus wie das Filmplakat eines Oscar-Gewinners! Und es sind bei weitem nicht alle Preise, die die US-Amerikanerin Ann Leckie im vergangenen Jahr mit ihrem Debütroman "Ancillary Justice" abgeräumt hat. – Das erhofft man sich höchstens in seinen allerheimlichsten Träumen, wenn man sich nach einer Reihe Kurzgeschichten erstmals traut, einen Roman zu schreiben, dass der dann derart einschlägt.
Mein Hauptresümee nach der Lektüre war ein unerwartetes: Nämlich wie leicht sich das Ganze liest! Das war nicht unbedingt zu erhoffen – all die hymnischen Rezensionen, denen man wirklich nirgendwo entgehen konnte, hatten da schon eine gewisse Schwellenangst aufgebaut: Von wegen sprachliche Herausforderung, innovative Genderbetrachtungen, verwirrende Identitäten und so – alles drin. Und trotzdem ist "Die Maschinen" überaus flüssig zu lesen, also keine Angst.
Die galaktopolitische Ausgangslage
Beginnen wir mal mit dem großen Rahmen – es ist das bekannte Szenario vom interstellaren Imperium. Unter den diversen menschlichen Sternenreichen in Leckies Romanwelt ist das der Radchaai seit Jahrtausenden auf kriegerische Expansion bedacht. In ihrer Vorgehensweise lassen sie dabei abwechselnd an das römische Reich, den britischen Kolonialismus und Nazi-Deutschland denken. Status und Hierarchie werden bei den Radchaai großgeschrieben, zudem haben sie einen ausgeprägten Hang zu Ritualen: von der Teezeremonie über die tägliche Interpretation von Omen bis zu ihrer Religion, die ein bisschen an den Hinduismus erinnert. Kurz: Von der Makro- bis zur Mikroebene ist hier alles penibel durchorganisiert.
Auftritt Breq auf der Gegenwartsebene des Romans. Die Ich-Erzählerin des Romans ist eine ehemalige Hilfseinheit, von Nicht-Radchaai als Leichensoldatin geschmäht: ein toter Mensch, dessen Körper einem KI-gesteuerten Kollektiv einverleibt wurde. Als letztes überlebendes Fragment ihres Kollektivs hält sich Breq derzeit auf einem Provinzplaneten außerhalb der Radchaai-Domäne auf, um einen ehrgeizigen Plan zu verwirklichen: Sie will eine antike Superwaffe erwerben, mit der sie die Herrin der Radchaai töten kann. Ungeplant gabelt sie dabei auch die drogensüchtige Leutnantin Seivarden auf und nimmt diese ebenfalls mit in die Heimat zurück.
Die Gendersache
... Leutnantin oder Leutnant Seivarden genau genommen. Denn wie wir später erfahren, handelt es sich bei "ihr" um einen Mann, und damit sind wir bei der ersten Besonderheit des Romans angelangt: Alle Figuren des Romans werden grundsätzlich als "sie" bezeichnet. Die Radchaai unterscheiden nicht nach dem biologischen Geschlecht – das spielt allenfalls beim Fortpflanzungsakt eine Rolle, in allen anderen sozialen Kontexten ist es bedeutungslos. Ursula K. Le Guin musste für die gleiche Grundidee in "Die linke Hand der Dunkelheit" noch ein Volk mit besonderer Biologie erfinden. Leckies Radchaai hingegen reicht es, die Konvention verinnerlicht zu haben, Gender als soziales Konstrukt zu verstehen.
Da wir es gewohnt sind, geschlechterdichotomisch zu denken, prägt diese sprachliche Besonderheit natürlich das Leseerlebnis. Im Deutschen sogar noch stärker, da der Übersetzer Bernhard Kempen hier auch sämtliche Hauptwörter, die im Englischen noch geschlechtsneutral waren, dem "sie" angepasst hat – also immer "Ärztin" für "doctor" usw. Im Vorwort des Romans erklärt Kempen seine Wahlmöglichkeiten, wie er mit dem generischen Femininum des Originaltextes umgehen konnte – er hat wohl einige Reaktionen vorausgeahnt. Es gibt auch tatsächlich in Leserforen lustige Statements von Empörten, die aber am Thema vorbeigehen – genausogut könnten sich die Radchaai schließlich auch alle als "er" bezeichnen. Die Chance war fifty-fifty.
Den – ablehnenden ebenso wie begeistert zustimmenden – Reaktionen zum Trotz ist das aber nicht das Hauptanliegen des Romans und schon gar nicht der Radchaai. Allenfalls hat Breq außerhalb der Radchaai-Domäne, wo man/frau so denkt und spricht wie wir, Probleme, das richtige Personalpronomen zu erwischen. Unwichtig beispielsweise im Vergleich zu dem Gschisti-gschasti, das die Radchaai ständig um das Thema rituelle Reinheit machen, was sich unter anderem im Tragen von Handschuhen äußert. (Erinnert mich ein wenig an Ricardo Pintos Fantasy-Trilogie "Steinkreis des Chamäleons", in der das Herrenvolk die unreinen Außenlande nur mit monströsen Plateau-Pumps betritt.)
Wir sind ich
Auf der in einem parallelen Strang erzählten Vergangenheitsebene des Romans – 19 Jahre zuvor – ist gerade ein Planet frisch annektiert worden und unsere Erzählerin steckt mitten im lokalpolitischen Hickhack. In buchstäblich vielfacher Weise – und damit sind wir bei der zweiten, wichtigeren Besonderheit des Romans. Nun ist unsere Erzählerin – dieselbe wie in der Gegenwart – ein riesiges Kriegsschiff mit tausenden Hilfseinheiten. Sie ist aber auch eine Armee von Leichensoldaten. Sie ist ein kleiner Trupp auf der Oberfläche des Planeten. Und sie ist ein einzelnes Individuum. All diese unterschiedlich großen Teilmengen des KI-Kollektivs verstehen sich jeweils als ein und dasselbe "ich".
In einer faszinierenden Passage lesen wir, wie "ich" (ein kleiner Landungstrupp mit der Bezeichnung Eins Esk) in den Orbit fliegt, wo sich "ich" (das Kriegsschiff "Gerechtigkeit der Torren") aufhält, mit dessen geistigem Verbund verschmilzt, als würde man zwei Mengen Wasser zusammenschütten, und dabei die ganze Zeit über "ich" bleibt. Ann Leckie geht dabei wirklich beeindruckend konsequent vor. Während uns andere Autoren lesetechnische Hilfestellungen geben, um diverse Klone/Avatare/Manifestationen/Proxys/was auch immer jederzeit voneinander unterscheiden zu können, verwendet Leckie stets nur ein Pronomen – ganz wie es dem für uns fremdartigen Denken der Erzählerin entspricht. Das hab ich in der Form tatsächlich noch nicht gelesen.
Derselbe psychedelische Effekt stellt sich beim eigentlichen Plot-Driver des Romans ein. Anaander Mianaai, die Herrin/der Herr der Radchaai, besteht nämlich aus tausenden identischen Körpern, die dennoch dieselbe Person sind. Oder zumindest waren, denn inzwischen ziehen offenbar nicht mehr alle Inkarnationen am selben Strang – was Mianaai aber nicht so recht wahrhaben will. Aufgrund ihrer "Schizophrenie" schwebt das Imperium seit einiger Zeit am Rande eines schleichenden Bürgerkriegs – und der droht nun endgültig auszubrechen.
Identitäten
"... besteht nicht jede Identität eigentlich aus Fragmenten, zusammengehalten durch eine passende oder nützliche gemeinsame Geschichte, die normalerweise niemals als Fiktion erkennbar wird?", denkt Breq einmal. Auf jeden Fall ist Identität das Kernthema das Romans: ob geschlechtlich, kulturell, kollektiv versus individuell – oder auch was das Spannungsfeld zwischen gehorsamer Pflichterfüllung und dem Drang, dem eigenen Gewissen zu folgen, betrifft. Letzteres spielt gerade in einer tendenziell faschistoiden Gesellschaft wie der der Radchaai eine wesentliche Rolle.
Neben vielem anderen ist "Die Maschinen" auch die Geschichte, wie eine solche Identität – die von Breq – immer mehr an Profil gewinnt (was auch belohnt werden wird). Dass Breq in der Zeit zwischen den beiden Handlungsebenen schon einen beträchtlichen Weg zurückgelegt hat, zeigt ihre Reaktion auf das Angebot einer Nicht-Radchaai-Ärztin, ihre ursprüngliche Identität (also die, bevor sie zur Leichensoldatin verwurstet wurde) wiederherzustellen. Für uns wie die Ärztin mag dies wünschenswert klingen, doch Breq lehnt ab: "Sie meinen, Sie können mich töten. Sie können meine Selbstwahrnehmung zerstören und sie durch eine ersetzen, die Sie akzeptieren können." Dieses Selbstbewusstsein spiegelt die Selbstverständlichkeit wider, mit der uns Leckie mit einer anderen Art des Denkens konfrontiert.
Unterm Strich
Aufgrund der Genderthematik liegen Vergleiche mit Ursula K. Le Guin, Joanna Russ oder James Tiptree Jr. nahe. Allerdings hat mich "Die Maschinen" auch an etwas völlig anderes erinnert, nämlich an "Dune". Nicht nur aufgrund der feudalen Gesellschaft der Radchaai, ihrer Rituale oder ihrer ausgefeilten Zeichensprache – ganz zu schweigen von den undurchsichtig verschachtelten Plänen der ProtagonistInnen. Sondern vor allem wegen der leicht abstrakten Wirkung, die die über weite Strecken von Dialogen getragene Handlung beim Lesen auf mich hatte. Ähnlich wie bei Frank Herbert hat sich auch hier mitunter der Eindruck bei mir eingestellt, es mit einem Drama (nicht übertragen, sondern im Sinne eines Theaterstücks gemeint) zu tun zu haben.
Zumindest in einem Punkt kann man denen, die den Roman nicht so mochten, aber zustimmen: Tempo ist nicht seine größte Stärke. "Die Maschinen" schreitet recht gemächlich voran – hat aber auch alle Zeit der Welt, es ist ja erst der Auftaktband einer Trilogie. Hoffentlich verkauft es sich gut genug, dass die weiteren Bände ebenfalls auf Deutsch erscheinen. Band 2, "Ancillary Sword", ist im Original bereits erhältlich. Ich freu mich drauf.
[Nachträgliche Anmerkung: Die Vorfreude war leider nicht berechtigt, mit Band 2 wurde Leckies Trilogie stinklangweilig. Auch die originellste Idee hält einen Text eben nur für eine begrenzte Seitenzahl über Wasser. Hier der Link zur Rezension von Teil 2, "Die Mission", der sich in einem Satz zusammenfassen lässt: Das Imperium trinkt Tee.]