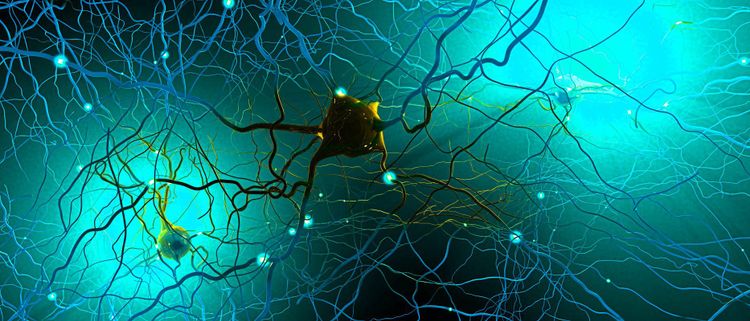
In den neun Monaten, in denen ein Fötus im Bauch der Mutter heranwächst, läuft ein unglaubliches Programm ab: Jene rund 86 Milliarden Gehirnzellen, aus denen das menschliche Gehirn besteht, fügen sich nach einem präzise orchestrierten Bauplan, der im Erbgut festgeschrieben ist, zusammen. "Zwischen dem dritten und sechsten Monat entstehen aus den Stammzellen pro Sekunde bis zu 1000 Neuronen", konkretisiert Simon Hippenmeyer, Neurobiologe am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg.
"Es ist das faszinierendste und schönste Organ unseres Körpers", stellt die Neurowissenschafterin Gaia Novarino, ebenfalls Gruppenleiterin am IST Austria, fest. Nüchtern betrachtet kann man sagen, dass das erwachsene Gehirn etwa eineinhalb Kilo wiegt und 20 Prozent des Sauerstoffs in unserem Blut verbraucht. Doch was genau sich in diesem sich ständig wandelnden Dickicht aus Neuronen abspielt, die mittels elektrischer Spannungsstöße über 100 Billionen Synapsen miteinander kommunizieren, zählt nach wie vor zu den größten Rätseln der Menschheit.
Fest steht, dass die DNA "nur" die Grundbausteine vorgibt und ein System implementiert, dass darauf ausgerichtet ist, mit jeder Information seine Schaltkreise neu zu verdrahten. Die Welt, die uns umgibt, unsere Erfahrungen und Sinneseindrücke formen unser Gehirn und seine Verbindungen permanent um – und das auf höchst effiziente Art und Weise. Dieses dynamische und adaptive System taufte der US-Psychologe William James "Plastizität". Der Neurowissenschafter David Eagleman von der Stanford University nennt es in seinem jüngsten Buch "Livewired" (2020) analog zu Hard- und Software "Liveware".
Black Box im Kopf
Zwar hat die Hirnforschung in den letzten Jahren beträchtliche Erfolge erzielt, insbesondere was das Verständnis der motorischen und sensorischen Fähigkeiten betrifft. Die Messung der Gehirnaktivität und bildgebende Verfahren ermöglichen es, Gefühlen, Vorstellungen und Denkmustern auf die Spur zu kommen. Und doch klafft eine große Lücke zwischen dem, was wir über unser Denkorgan wissen, und dem, was uns zu dem macht, was wir sind. Die sogenannten höheren kognitiven Fähigkeiten, das Bewusstsein, das Gedächtnis, das Denken an sich, sind nach wie vor eine Blackbox.
Die Ergebnisse der modernen Neurowissenschaften und eine Vielzahl an neuen Technologien machen jedoch heute komplett andere Forschungsansätze möglich, ist der deutsche Hirnforscher Wolf Singer überzeugt. Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen wisse man nun, dass das Gehirn "ein extrem distributiv organisiertes System" sei, "das sich ohne einen Dirigenten zurechtfindet, sondern sich selbst organisiert", sagte der emeritierte Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt voriges Jahr bei einem Vortrag in Wien. "Wir haben die lineare Systemtheorie abgelöst, wir sind jetzt mehr in der Welt der Komplexitätstheorie", sagt Singer.
Wie Synapsen lernen
Befindet sich die Hirnforschung also dank neuer Technologien am Beginn einer neuen Epoche, wie Singer postuliert? "Technologie ist der Schlüssel", sagt der Neurowissenschafter Peter Jonas vom IST Austria. 2016 wurde er von Wissenschaftsministerium und Wissenschaftsfonds (FWF) für die Erforschung der grundlegenden Mechanismen von Synapsen im Hippocampus mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet.
Er bezeichnet als eines der "Durchbruchereignisse der letzten Jahre", dass synaptische Strukturen und ihre Prozesse direkt im Gewebe gemessen werden können – räumlich in Nanometerauflösung und zeitlich in Mikrosekunden. Eines der primären Ziele von Jonas: "Wir wollen herausfinden, wie Synapsen sich verhalten, um höhere Gehirnfunktionen zu verursachen, also etwa wie im Hippocampus unvollständige Informationen mithilfe des Netzwerks ergänzt werden – eine der grundlegenden Funktionen der Erinnerung."

Es gilt dabei, einerseits die Aktivität in den Nervenzellen zu messen und andererseits zu sehen, wie sie sich dabei verändern. Jonas hat dazu einige Technologien federführend weiterentwickelt: Die "subzelluläre Patch-Clamp-Technik" ermöglicht, elektrische Signale, die per synaptischen Spalt übertragen werden, direkt an der Ausgangszelle abzufangen und gleichzeitig die Antwort an der Zielzelle zu beobachten. "Derzeit können wir die Vorgänge in einem Ensemble von acht Zellen gleichzeitig messen. Das ist eine schöne Methode, um die Interaktionen in einem solchen Mininetzwerk studieren zu können", schildert Jonas.
Gedächtnis-Blasen
Mit der 2013 entwickelten und von Jonas verfeinerten "Flash and Freeze"-Methode wiederum werden Neuronen mit Licht stimuliert und binnen einer Tausendstelsekunde schockgefroren, um sie unter dem Elektronenmikroskop untersuchen zu können. Denn damit Gehirnfunktionen wie das Erinnern ausgeübt werden können, muss sich etwas in den Strukturen des Neuronengeflechts verändern.
Wie eine solche Veränderung aussieht, konnten Jonas und sein Team kürzlich zeigen: Sie nahmen Bläschen mit Neurotransmittern auf, deren Verlagerung an der Synapse mit dem Kurzzeitgedächtnis gekoppelt ist. "Das legt nahe, dass Informationen in Form solcher Vesikelpools abgespeichert werden", sagt Jonas. Ein Schritt, um dem Lernprozessen des Gehirns auf die Spur zu kommen.
Neben technischen Fortschritten bei der Elektronenmikroskopie und der Messung von Signalen direkt an der einzelnen Zelle waren in den vergangenen Jahren auch Weiterentwicklungen in der Genetik bahnbrechend – allen voran Hochgeschwindigkeitsgensequenzierungen und die Gen-Schere Crispr. Per Optogenetik, zu deren Wegbereitern der österreichische Neurophysiologe Gero Miesenböck gehört, kann die Aktivität von Neuronen mit Licht gezielt gesteuert werden. Neuronale Schaltkreise lassen sich so auf einem ganz neuen Level untersuchen.

Auf genetisch veränderten Zellen, die mit Farbmarkern versehen werden, basiert auch die von Simon Hippenmeyer entscheidend weiterentwickelte Mosaic-Analysis-with-Double-Markers-Methode (MADM-Methode). Damit können er und sein Team im Mausmodell bunt gefärbte Neuronen auf ihrem Weg von der Stammzelle bis in die Großhirnrinde verfolgen. So lässt sich visualisieren, wie sich Zellen, in die ein genetischer Defekt eingebaut wurde, der beim Menschen zu schwerwiegenden Gehirnerkrankungen führt, im Vergleich zu gesunden Zellen verhalten.
"Es ist eine spannende Zeit für die Hirnforschung", sagt Hippenmeyer. "Wir können mit heutigen Technologien eine Million Zellen gleichzeitig bei ihrer Entwicklung beobachten. Das war vor fünf Jahren noch nicht möglich." Mit der MADM-Methode soll künftig systematisch untersucht werden, wie sämtliche Gene die Gehirnentwicklung auf Zellebene beeinflussen. Auch wenn sich das menschliche Genom nur geringfügig von dem der Maus unterscheidet – welche Codes das menschliche Gehirn so außergewöhnlich machen, liegt noch im Dunkeln. Dazu brauche es andere Ansätze, sagt Hippenmeyer.
Autismusforschung an Protogehirnen
Einen solchen verfolgt Gaia Novarino, die sich der Erforschung der nach wie vor unbekannten Ursachen von Autismus widmet. Sie und ihr Team programmieren Gehirn- und Blutzellen, die von Kindern mit Autismus stammen, zu Stammzellen um. Die daraus entwickelten Neuronen werden in Kulturschalen zu Organoiden, also winzigen Protogehirnen gezüchtet. "Wir können dadurch die Neuronen eines Individuums untersuchen, ohne invasiv zu sein", sagt Novarino im IST-Austria-Science-Talk. "Das ermöglicht uns, Prozesse, die sehr früh in der Entwicklung des Gehirns ablaufen, im Labor zu untersuchen und zu sehen, was im Zusammenhang mit einer Mutation passiert."
Für den theoretischen Neurowissenschafter Tim Vogels, der im vergangenen August von der Oxford University ans IST wechselte, ist das eine "revolutionäre Technik", da mit dieser Methode "der simpelst mögliche Schaltplan erarbeitet werden kann", den man anschließend Schritt für Schritt erweitern könne. Da derartige Experimente auch im Modell simuliert werden können, sei so ein direkter Abgleich zwischen Theorie und Praxis möglich.
Von der Zelle zum Verhalten
Während Neurobiologen sich bis zu den kleinsten Strukturen innerhalb der Gehirnzellen herantasten, um sich dann zu größeren Netzwerken voranzuarbeiten, setzen Psychologen und andere Kognitionsforscher bei dem an, was das Gehirn hervorbringt, also primär beim Verhalten. Auch hier ging man in den vergangenen Jahren dazu über, nicht nur die Aktivität einzelner Gehirnregionen von Versuchspersonen bei der Bewältigung verschiedenster Aufgaben zu messen, sondern die Konnektivität, also die Verbindungen und Netzwerke im Gehirn, in den Blick zu nehmen.
Bild nicht mehr verfügbar.
Immer besser auflösende Bildgebungsverfahren, Algorithmen und Machine-Learning-Methoden ermöglichen immer genauere Analysen von höheren Gehirnfunktionen, insbesondere Lernen und Gedächtnis – und machen Hoffnung, Krankheiten wie Alzheimer und Demenz besser zu verstehen.
Schließlich liegt eines der großen Potenziale für Durchbrüche in der Hirnforschung in den Computerwissenschaften. Die riesigen Datenmengen, die in Experimenten generiert werden, können dazu dienen, zumindest kleine Bereiche des Gehirns am Computer nachzubauen und "in silico" zu analysieren – um so zu einem besseren Verständnis der Denkvorgänge zu gelangen. Umgekehrt profitiert die Künstliche-Intelligenz-Forschung von den Ergebnissen der Neurobiologen. Nicht von ungefähr lehnen sich künstliche neuronale Netzwerke an Prozesse im Gehirn an.
Um das unglaublich komplexe Netzwerk in unseren Köpfen zu verstehen, müssen sich auch unterschiedliche Disziplinen weiter vernetzen. Denn auch wenn wir noch weit weg sind von einem Gesamtverständnis des komplexen Wunderwerks Gehirn und es noch große Gräben zu überwinden gibt zwischen der Nervenzelle und dem menschlichen Verhalten – die neuen Technologien, die sich auf allen Ebenen durchsetzen, lassen vermuten, dass eine neue, tiefgreifende Epoche der Hirnforschung längst begonnen hat. (Karin Krichmayr, 31.1.2021)