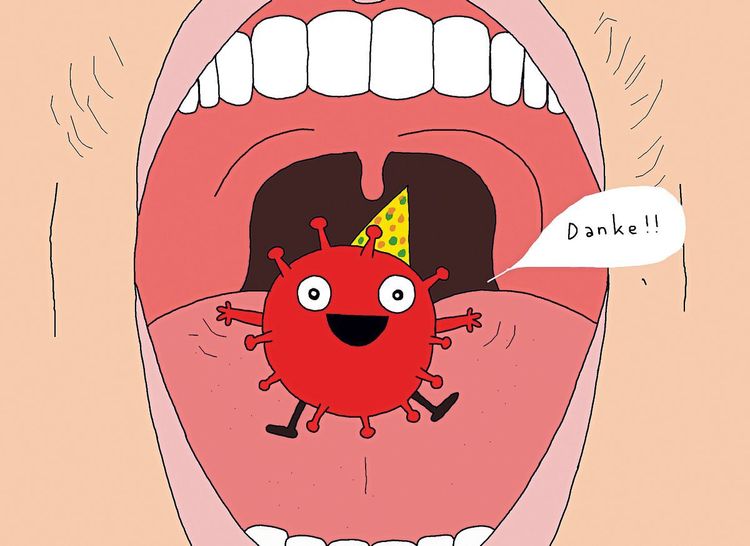
Danke!, sagt der Star des vergangenen Pandemie-Jahres. Das Coronavirus, gezeichnet von der Künstlerin Stefanie Sargnagel.
Was soll ich sagen? Eines muss ich sagen, und ob es wahr ist, den Beweis für die Wahrheit, hat zum Beispiel der Verleger des Zsolnay-Verlags, Herbert Ohrlinger. Jetzt steht der Verleger nicht nur hinter meinem Buch, sondern sogar in meinem Buch. Man wird sehen, wie der Buchhandel sich auf die Dauer macht und wer dann noch irgendwo steht. Wo steht aber der Autor?
Es ist jedenfalls wahr, dass der Titel dieses Buches Lachen und Sterben mit dem Coronavirus gar nichts zu tun hat, und es ist sogar wahr, dass mir das Virus gar nicht ins Konzept passt. Es ist ja Corona nicht bloß ein Virus, sondern auch eine eigene Textgattung geworden – ein ganzes Theaterstück über eine Pandemie konnte nicht aufgeführt werden wegen der Pandemie. Kultur ist, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt. Einmal wollte ich sogar ein Gedicht veröffentlichen – der Redakteur lehnte freundlich ab, das Gedicht Der Tod im Haus – in diesem Buch glücklich abgedruckt – spiele unvermittelt, also ohne die künstlerisch gebotene Indirektheit, auf das Coronavirus an.
Das Virus gab es aber gar nicht, als ich das Gedicht schrieb, man kann die Baugesellschaft fragen, die das Haus neben dem meinen abriss, sodass eine Wand meiner Wohnung nackt in der Häuserzeile stand. 75 Prozent meiner Besucher erkannten mein einseitig alleinstehendes Heim nicht wieder. Sie hatten mitten in ihrer Heimatstadt belastende, verstörende Fremdheitsgefühle und fuhren gleich weiter in Gegenden, die sie besser zu kennen glaubten. Ich machte im informierten Kreis, in der gehobenen Bildungsschicht, den pädagogischen Vorschlag, Corona als Textsorte in die Maturaprüfung aufzunehmen, zumal ja für die Matura heute weniger Literatur im alten Sinn gefragt ist als zum Beispiel die Sorte Leserbrief an die Krone, die ja als Kronen Zeitung mit ihrem Eigennamen schon wiederum von Corona erzählt.
Es gibt kein Entkommen
Es gibt kein Entkommen (oder – sollte es schon vorbei sein – damals, damals gab es kein Entkommen), es sei denn durch die absurde Ästhetisierung, die mir, einem Angehörigen der extremen "Risikogruppe", am Herzen liegt. "Wir" stellen eben die meisten Toten, "wir" mit unseren "Vorerkrankungen". Dafür waren wir schon in den Fünfzigerjahren auf der Welt, standen mit beiden Beinen im jungen Leben und wissen heute: "Corona, Corona, Corona" – das muss man singen im Stile von Vico Torriani, einem Schweizer, der auf Italianità machte und dessen Italienisch, obwohl es perfekt war, stets nach deutschem Touristen in Caorle klang. Auch Caterina Valente hätte ohne weiteres mitsingen können: "Corona, Corona, Corona".
Ob ich deppert bin, ein depperter Snob, fragt mich jemand im informierten Kreis, aus der gehobenen Bildungsschicht. Es sei doch klar, wenn Leben und Sterben an Corona hängt, dass da mindestens eine Textsorte herausschaut. Ecce homo, c’est la vie – ich gebe alles zu, und wenn die Thematisierung einer Menschheitsplage businesslike erfolgt, bin ich auch dabei. Schließlich arbeite ich auf demselben Feld. Ich habe keine Ahnung, ob die Allmacht, die das Virus nicht zuletzt durch die Dauerrede darüber genießt, angemessen ist oder ob sich die Menschen zu einem Tunnelblick verdammt haben, mit dem sie um sich blicken und angstlüstern immer nur ES sehen. Aber auf einmal scheinen immer mehr davon genug zu haben, und sie sehen ES überhaupt nicht mehr, weil sie ES einfach nicht mehr sehen wollen. Wohin wird das führen?
Lachen und Sterben hat ursprünglich gar nichts mit meiner über Nacht gekommenen Erkrankung zu tun. Meine Zugehörigkeit zur großen Menge der hospitalisierten Personen kam viel später. Wer krank ist, hat aber etwas zu erzählen, ich diese Anekdote: Nachdem ich ins Spital eingeliefert worden war, ersuchte meine Freundin Dorit den an mir diensthabenden Arzt um eine Auskunft, wie es denn um mich stehe. Zufällig kannte mich der Arzt aus dem sogenannten normalen Leben. Der Freundin teilte er mit, dass mein Tod wahrscheinlich sei, und er fügte hinzu: "Er hat sich ja immer für den Tod interessiert." Ja, das stimmt, und auch der Tod hat sich für mich interessiert.
Sicher sein, dass es kommt
Ich habe ihn mir am Beginn des Buches Sämtliche Leidenschaften schon einmal vorgenommen, persönlich hat er mich ja noch nicht eingeholt, aber es ist nicht zu leugnen, dass seine Vorwegnahme in Gedanken der Vorbereitung auf ihn dient: Minimierung der Überraschungsmomente bei gleichzeitiger Resignation angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass es erstens anders kommt, als man zweitens denkt. Aber man kann sicher sein, dass es kommt. Das ist doch komisch, wenn auch nicht lustig. In der Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens lässt Bertolt Brecht singen: "Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch ’nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht." Theologisch heißt das, und die Sentenz wird Pascal zugeschrieben: "Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne." Sicher, das ist das Konzept von Gott: Wer zuletzt lacht, lacht am besten, und das kann nur ER sein.
Ein guter, ein braver Theologe muss darauf aufpassen, dass sein Herrgott am Ende nicht als der große Zyniker dasteht, der über die Idioten lacht, die er geschaffen hat. Da gibt es aber nichts zu lachen, und Gott lacht freundlich über unsere Pläne, über die liebenswürdige, kindliche Naivität, mit der wir glauben, die gewünschte Zukunft zu haben. Der Mensch ist ein Kind Gottes, und daher ist er, wie es in Brechts Ballade heißt, nicht schlecht genug für dieses Leben: "Denn für dieses Leben / Ist der Mensch nicht schlecht genug. / Doch sein höh’res Streben / Ist ein schöner Zug."
Mehr als ein schöner Zug
Mehr als ein schöner Zug ist die menschliche Hingabe an das Höhere nicht (also an das, was die eigene Schlechtigkeit überhöht), immerhin kann man versuchen, an den schönen Zug anzuknüpfen. Falls nur ein Schöngeist dabei herauskommt, hat man halt Pech gehabt. Zuhause bei sich ist der Mensch (wer immer "der Mensch" ist) weder in seinem schönen Zug noch in seiner Schlechtigkeit, aber in beidem kann er höchste Präsenz erringen, furchtbare oder befreiende Gegenwart. Nein, Lachen und Sterben ist kein Thema, das äußerer Anlässe bedarf, auch wenn solche Äußerlichkeiten sich manchmal in das Innere der Seelen hineinfressen können und dann keine Äußerlichkeiten mehr sind. Lachen und Sterben spielt auch nicht auf das Sich-Totlachen an. Diese Floskel kommt vom Neid darauf, dass in der Tragödie alle, die auf sich halten, spektakulär sterben dürfen. So eine Wirkung will die Komik auch haben.
Vorsichtig gesagt, enthält die Zusammenstellung von Lachen und Sterben eine Utopie, die das "amor fati" unterläuft. "Amor fati" ermöglicht einen Zustand, durch den man sein Schicksal liebt (auch weil es das höchsteigene ist), selbst wenn es grauenhaft oder zerstörerisch daherkommt. Im Lachen sehe ich eine Chance, dasselbe Schicksal auszulachen und entsprechend dramatisch lachend unterzugehen. Das Theorem von "amor fati", von der Liebe zum (eigenen) Schicksal unterschlägt die Unterwerfung, die Akzeptanz eines Leidensweges, den man heroisch inszeniert. Das Lachen weist solche Zumutungen von sich und spielt sich im letzten Moment noch für ein wenig Souveränität auf. Beide Konzepte sind Utopien und als solche Orientierungen, die realiter nur in Bruchstücken vorkommen. Von Brüchen soll man angeblich lernen können, nämlich vor allem, wie man sich ein integrales Ganzes vorstellen möchte. Mit Utopien dieser Art versucht man, mit einer Essenz die Existenz zu programmieren. Aber, wie gesagt, mach nur einen Plan (...)
Eine finstere Zeit
Unter Corona haben (hatten?) auch wir eine finstere Zeit. Man kann sich in solchen Zeiten die Frage stellen, ob der Mensch gut ist oder böse. Die Frage ist unbeantwortbar, man findet Belege für beides, in den USA sind fünfhundert Mal mehr Waffen verkauft worden als vor der Krise. Ein Käufer erklärt es dem Fernsehen: "Wenn einer wegen Corona durchdreht, ist es gut, wenn man etwas gegen ihn in der Hand hat!" In China, so berichtet ein Reporter, werden Ausländer als Sondermüll bezeichnet, der entsorgt gehört. Aber überall gibt es freiwillige Helfer und Arbeiter und Angestellte, die durch ihr Wirken die Zivilisation aufrechterhalten.
Man ist geneigt, das Gute und das Böse am Menschen gegeneinander auszuspielen: Entweder Solidarität oder Untergang, entweder Corona-Party am Strand oder einsam daheim verharren in der Abwehrhaltung gegen das Virus. Die Grauzonen sind weniger charmant, aber umso mehr in der Realität verankert. Lachen jedenfalls hat, siehe oben, eine metaphysische Seite, es hat aber auch eine rein professionelle Seite, oder um es – Rudi Carrell hart variierend – zu sagen: "Komiker ist ein Beruf, ist ein Beruf, den der Herrgott schuf."
Ausgangsbeschränkung: Es ist zweierlei, dem ich alles unterordne, was ich mir zur Lage in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen denke (dachte?). In den wesentlichen Fragen gibt es erstens (noch) keine sicheren Antworten. Alle müssen mit und in der Ungewissheit leben und sterben. Dieses banale Prinzip kann man jedoch nicht als Grundlage dafür verwenden, sich keine Gedanken zu machen. Der Optimismus, der seit der Aufklärung mit dem Selberdenken verbunden ist, ist (noch) in Kraft: Also nicht bloß denken, was einem zum Beispiel eine Regierung als das einzig Denkbare vorschreibt. Die Regierung, selbst die wahrhaftigste, muss Sicherheit suggerieren, auch wenn es keine geben kann. Die Unsicherheit hat zumindest diese eine garantierte Folge: Im öffentlichen Raum konkurrieren viele Vermutungen als Gewissheiten, und heute heißt es: "Jetzt Sorge vor zweiter Corona-Welle." Dabei hat gestern ein Virologe vom Mount Sinai Hospital (New York) im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bereits die dritte Welle angesagt.

Das zweite Prinzip, an das ich mich halte, lautet: Man muss aus den angegebenen Gründen weniger dogmatisch, sondern entschieden hypothetisch sprechen. Das heißt, man muss in seinen Kommentaren zur Lage deutlich machen, dass man sich vielleicht nur in unbewiesenen Annahmen ergeht. Das wäre ja kein Problem, gäbe es in dem Meer des Ungewissen nicht tatsächlich auch Tatsachen, über die man sich besser jede Meinung erspart, weil man bewiesene Tatsachen einfach zur Kenntnis nehmen muss. So tritt hier ein altes Problem auf, das Problem, dass der Zweifel vernünftigerweise kein Selbstzweck ist, sondern dazu dient, das Unbezweifelbare, wenn nicht sogar ein "fundamentum inconcussum", ein unerschütterliches Fundament, zu finden. Man sollte skeptisch bleiben, aber zugleich stets dazu imstande sein anzuerkennen, was man bei Verstand nicht abstreiten kann. Das kommt einem doch leicht vor, aber man studiere die sogenannten sozialen Medien. Die Freude daran, just das Unbestreitbare abzustreiten, wollen sich viele nicht nehmen lassen.
Hilfe beim Optimisten holen
Ein anderes Problem, das immer wiederkehrt, ist das von Optimismus und Pessimismus. Im Radio qualifizierte ein Redakteur die Aussagen eines Unternehmers, eines "Hauptaktionärs", als sehr optimistisch. Der Mann antwortete: "Mit Pessimismus geht gar nichts." Da hat er recht, Pessimismus ist Selbstlähmung. Ein Pessimist kann sich die eigene Einschätzung, dass alles schlecht und immer schlechter wird, leicht selbst erfüllen. Pessimisten verwirklichen aus Eigenem die Aussichtslosigkeit, die sie in die Lage projizieren.
Hat sich der Pessimist selbstgefällig dem Aussichtslosen verschrieben, so gibt es Optimisten, die in ihrem Tatendrang nichts als blöd sind. "Ein Optimist", hat Karl Valentin gesagt, "ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind." Das ist traurig, aber anstatt über diesen Sachverhalt gründlich zu trauern, beschäftigt die Gesellschaft eine große Menge von Optimisten, die beteuern (und zwar nicht selten für Geld), dass alles gut wird. Uns Trauernden wird gesagt: "Suchen Sie sich professionelle Hilfe bei Ihrem Optimisten!"
Die Profis des Optimismus, die einem das schon zitierte "Glücksdiktat" vorbuchstabieren, finden sich unter Psychologen, unter Coaches, Ärzten und Journalisten. Die professionellen Optimisten versprechen mehr oder weniger deutlich, die Negativität, das Unglück aus dem Leben austreiben zu können. Ollas leiwand auf Wienerisch, man muss es sich nur einbilden, den Coach bezahlen, sein Buch kaufen, dann klappt es. Es gibt Leute, deren These lautet: Nach Corona (mit Corona und durch Corona) wird die Schöne Neue Welt beginnen. Manche deuten es Gott sei Dank nur vorsichtig als Möglichkeit an. Dabei üben sie sich im Schönsprechen: Die Pandemie sei eine "Einbruchstelle für eine fundamentale Änderung der sozio-politischen Ordnung". Im geschichtsphilosophischen Smalltalk wird die Möglichkeit eingeräumt, "dass man später von einer Epochenwende im Jahr 2020 sprechen wird". Vielleicht. Aber ob es eine Wende zum Guten, auch nur zum Besseren wird?
Wird es wieder wie es war?
Andere sind sich da sicher. Der Schock brächte Gutes in die Welt, es wird eine Art Reinigung gewesen sein. Viele werden sich erleichtert fühlen: Die Hetzerei im Alltag, das Quatschen in den Medien – es wird sich erledigt haben. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar "neue Möglichkeitsräume" eröffnen. Halbwegs intelligente Menschen ringen nach Worten, auch nach einem Wort, mit dem man die Polarisierung von Pessimismus und Optimismus beenden könnte. Eine Lösung ist: Eh wurscht, oder mit einem Aphorismus von Karl Valentin ruhig hingesagt: "Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch!" Man höre die schöne Sprachregelung: Weder blauäugige Optimisten noch resignierende Pessimisten wollen wir sein, sondern Possibilisten, also Menschen, die Möglichkeiten sehen. Vielleicht muss man das gar nicht. Sibylle Berg, die Dichterin, wurde gefragt: "Wird es jemals so sein, wie es war?" Sie antwortete: "Ich fürchte, ja." Näheres über die Zukunft erläuterte sie so: "Die, die nicht Bankrott gehen, werden weitermachen wie bisher. Andere werden neu anfangen, und wieder andere können sich aufhängen." Kein Zweifel, zu welcher Gruppe ich gehöre. (Franz Schuh, ALBUM, 12.3.2021)