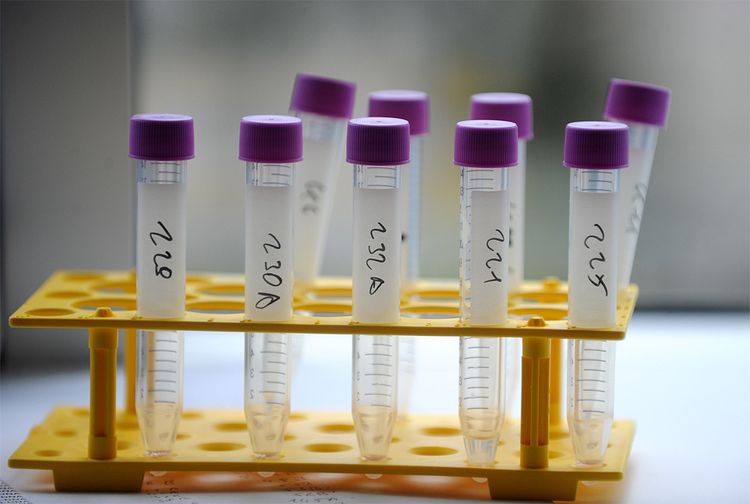
Es war eigentlich vorhersehbar: Seit Monaten warnen Innovationsökonomen, Forschungseinrichtungen und einzelne Wissenschafter vor einer drohenden Geldknappheit im österreichischen Forschungssystem. Der Hintergrund: Die Sonderdotierung der praktisch leeren Nationalstiftung von rund 100 Millionen Euro jährlich seitens des Finanzministeriums läuft aus. Zusammen mit dem – aus den Einnahmen aus dem erhöhten Steuersatz für Besserverdiener gespeisten – Österreich-Fonds mit Ausschüttungen in Höhe von jährlich rund 33 Millionen Euro wurden insgesamt 140 Millionen jährlich an Forschungseinrichtungen wie den Wissenschaftsfonds FWF, die Forschungsförderungsgesellschaft FFG oder die Akademie der Wissenschaften ÖAW vergeben.
Der FWF, der Mittel für die Grundlagenforschung im Wettbewerb vergibt, erhielt zuletzt etwa 25 Millionen Euro jährlich und nutzte sie unter anderem dazu, Zukunftsprogramme für Jungwissenschafter aufzusetzen. Der im türkis-grünen Regierungsprogramm angekündigte Fonds Zukunft Österreich harrt seiner Umsetzung. Zur aktuellen Situation nimmt der Innovationsökonom Jürgen Janger vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) Stellung.
STANDARD: Der FWF setzt einige Programme, die bisher über die Nationalstiftung finanziert wurden, aus. Darunter auch doc.Funds, also die Ausbildung der künftigen Generation der Wissenschafter. Ein nachvollziehbarer Schritt?
Janger: Ja, einer, der natürlich einer kaufmännisch vorsichtigen Budgetgebarung entspricht – ich kann Leuten nicht Geld versprechen, das ich nicht habe. Warum genau diese Programme und nicht andere, weiß ich nicht bzw. habe ich dazu keine Information seitens des FWF gelesen. Man könnte selbstverständlich darüber diskutieren, welche Programme welche forschungspolitischen Ziele mit welcher Effektivität adressieren und welche daher die höchste Priorität hätten. Ein solcher Diskussionsprozess ist mir aber nicht bekannt.
STANDARD: Warum ist es so schwierig, dieses Geld aufzubringen?
Janger: Die Frage der Mittelherkunft über die Nationalstiftung oder den diskutierten Zukunftsfonds ist eine untergeordnete Frage der Forschungsfinanzierung. Wie viele öffentliche Mittel brauche ich zur Erreichung welchen Ziels? Angesichts der Bedeutung des Themas Forschung und Innovation für Gesellschaft und Wirtschaft und angesichts der Dimension der sonstigen öffentlichen Forschungsfinanzierung – jenseits der vier Milliarden Euro jährlich – sind 100 Millionen Euro keine große Summe.

STANDARD: Der FWF hat doch insgesamt mehr vom Bund erhalten. Könnte man dann nicht sagen, das Minus durch den Ausfall der Nationalstiftung ist ausgeglichen?
Janger: So viel den Jahresberichten des FWF zu entnehmen ist, gingen die Trends bei den Ausschüttungen zuletzt dorthin, wo jetzt der neue Bundesbudgetbeitrag ist – und wir dürfen nicht vergessen, dass die Universitäten über die Leistungsvereinbarungen starke Anreize erhielten, mehr Professorinnen und Professoren einzustellen, die natürlich auch wieder zum FWF kommen, um Anträge zu stellen. Das heißt, um Erfolgsquoten stabil zu halten, braucht der FWF mehr Budget. Und eigentlich – wenn Forschungsexzellenz ein Ziel der Forschungspolitik ist – brauchten wir eine deutliche Steigerung des Anteils wettbewerblich vergebener Mittel in der Grundlagenforschung.
STANDARD: Ein fixer Plan für die nahe Zukunft scheint die Exzellenzstrategie zu sein. Ist das unter gegebenen Bedingungen noch sinnvoll?
Janger: Nein, weil diese Initiative dann zulasten anderer wettbewerblich vergebener Programme gehen würde. Wichtig ist zunächst die gesamte Summe der wettbewerblich eingesetzten Forschungsförderung und wie hoch ihr Anteil an der gesamten Grundlagenforschungsfinanzierung ist – dazu gibt es Evidenz. Zur relativen Wirkung unterschiedlicher Förderschienen, etwa zur Exzellenz innerhalb des FWF-Portfolios, gibt es weniger Evidenz.
Es kann schon sein, dass die von der Forschungspolitik gewünschte Wirkung bei manchen Förderschienen höher ist als bei anderen und es Sinn ergeben würde, sich auf diese zu konzentrieren. Die Mittel des FWF sind im internationalen Vergleich so gering, dass solche Wirkungsunterschiede zwischen Förderschienen wohl bei weitem nicht das Hauptproblem der zu niedrigen wettbewerblichen Mittel kompensieren können.
STANDARD: Dabei hieß es zuletzt: aus der Krise heraus investieren.
Janger: Ich finde, das wäre nicht schwer. Wir haben dermaßen große private und öffentliche Investitionsbedürfnisse etwa für Klima und Digitalisierung, dass wir ja nicht lange überlegen müssten, wo wir das Geld investieren. Breitbandausbau, WLAN in Schulen, öffentlicher Verkehr, erneuerbare Energien, Förderprogramme zur Unterstützung des Einsatzes neuer digitaler Technologien in KMUs, Grundlagenforschung im Bereich künstliche Intelligenz und Energieproduktion sowie -speicherung – wir können hier noch zehn weitere Beispiele nennen, wo viele, wie ich glaube, einverstanden wären, mehr zu investieren, um ein umweltverträgliches Herauswachsen aus der Krise zu unterstützen. Das aktuelle Zinsumfeld ermöglicht jedenfalls, deutliche Akzente zu setzen.
STANDARD: Es scheint hierzulande schwierig, Grundlagenforschung und ihre Bedeutung plausibel zu machen. Woran liegt das?
Janger: Das ist spekulativ, aber einerseits kommt in Österreich nach wie vor nur ein unterdurchschnittlich großer Bevölkerungsanteil in Berührung mit Grundlagenforschung, etwa aufgrund eines Hochschulstudiums; andererseits fehlen auch allen geläufige Beispiele, wo Grundlagenforschung etwa zu neuen, großen Unternehmen oder technologischen Lösungen geführt hätte.
Ein für Österreich schmerzhaftes Schrumpfen des Tourismus und seiner Beschäftigungsmöglichkeiten wird uns vielleicht stärker zur Frage bringen, welche Faktoren Strukturwandel treiben können, und damit auch wieder die Bedeutung der Grundlagenforschung stärker ins Licht rücken. (Peter Illetschko, 15.3.2021)