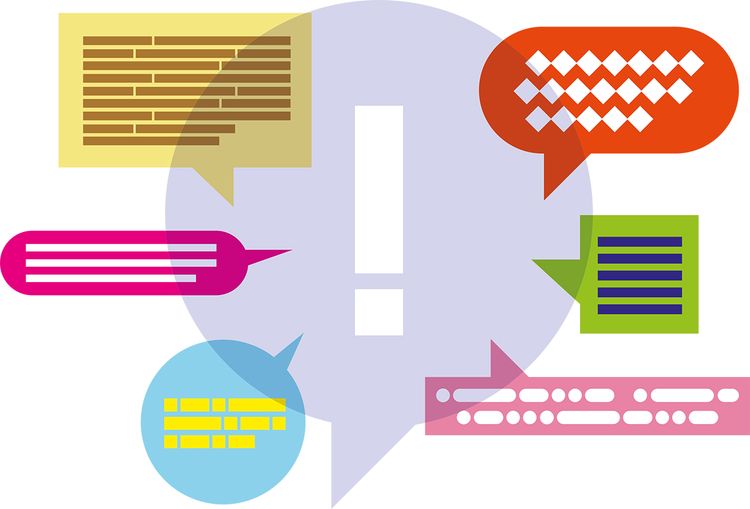
Rund 6.000 Sprachen gibt es weltweit – viele davon sind vom Aussterben bedroht.
Ob Kleinod, blümerant oder Wählscheibe – manchen Wörtern begegnet man immer seltener. Schade eigentlich. Sie kommen aus der Mode, werden vergessen oder beschreiben etwas, das es längst nicht mehr gibt. Auch wenn manche den alten Wörtern nachweinen, ist die deutsche Sprache, die derzeit von über 180 Millionen Menschen gesprochen wird, selbst nicht in Gefahr.
Ganz im Gegensatz zu Aramäisch, Burunge oder Burgenlandkroatisch – nur drei von tausenden gefährdeten Sprachen. Von den rund 6000 Sprachen sind laut Unesco rund 43 Prozent vom Aussterben bedroht, darunter über 20 europäische. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Hälfte der Sprachen verschwunden sein, prognostizieren manche Linguisten. Schon heute sprechen rund 50 Prozent der Weltbevölkerung nur 50 Sprachen.
Inzwischen haben sich weltweit etliche Initiativen gegründet, um den Sprachenverlust zu stoppen. Wikitongues ist eine von ihnen. Vor rund sieben Jahren gestartet, wollte die Organisation ursprünglich vom Aussterben bedrohte Sprachen dokumentieren. Was eigentlich das Metier von Linguistinnen und Linguisten war, wurde zu einer kleinen Bewegung. Innerhalb weniger Jahre arbeiteten tausende Freiwillige mit und steuerten Aufnahmen von selten gewordenen Sprachen bei.
Aktivismus statt Konservierung
Inzwischen ist Wikitongues mehr auf Sprachenaktivismus umgeschwenkt. Auch wenn Dokumentation noch heute ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist, wurde der Organisation bewusst, dass das rein museal anmutende Konservieren das Sprachensterben nicht stoppen könne. "Wir wollen allen Menschen ermöglichen, ihre Sprache und Kultur am Leben zu erhalten", sagt Kristen Tcherneshoff, Programmdirektorin bei Wikitongues. Die NGO will die Öffentlichkeit für Sprachverlust sensibilisieren, hilft indigenen Gruppen bei der Organisation von Rettungsprojekten und stellt Lernmaterialien zusammen.
"Viele Menschen glauben, dass Sprachenverlust eine natürliche Entwicklung sei", sagt Tcherneshoff. "Dabei ist es eine Konsequenz einer Politik der Assimilierung." Vor allem in Kolonialzeiten wurden viele indigene Sprachen absichtlich vernichtet. Noch 1972 sagte der französische Präsident Georges Pompidou öffentlich, dass in einem Frankreich, das Europa prägen wolle, kein Platz sei für regionale Sprachen und Kulturen. Die Europäische Charta der Regionalsprachen hat Frankreich, nebst Italien und Portugal, nie umgesetzt. Auch China und die Türkei unterdrücken bis heute sprachliche Minderheiten.

Aber wäre die Welt nicht offener und kommunikativer, würden alle eine Weltsprache wie Englisch sprechen? "Das klingt nach einer sehr langweiligen Welt", holt Tcherneshoff tief Luft – und beginnt die Vorteile von Sprachenvielfalt aufzuzählen. Studien haben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein haben und länger in der Schule bleiben – auch weil Eltern leichter bei den Hausaufgaben helfen können. Außerdem ist die Suizidrate unter aktiven Muttersprachlern geringer.
Auch auf das Gehirn hat Mehrsprachigkeit einen positiven Einfluss. Sprachen zu lernen soll Demenz entgegenwirken und die Konzentrationsfähigkeit fördern. Auch die Wirtschaft profitiert von Sprachenvielfalt: Laut Studien sollen bis zu zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Schweiz von der Mehrsprachigkeit des Landes abhängen. Und letztendlich hängen auch Klimakrise und Sprachenverlust zusammen, wie einige Studien bescheinigen. Dürren und Naturkatastrophen lassen Gebiete unbewohnbar werden, führen zu Fluchtbewegungen und reißen Sprachgemeinschaften auseinander. Gleichzeitig geht mit Sprachen immer auch ein Stück Menschheitswissen, etwa über die Natur, verloren.
Die Technologie trägt dabei eine gewisse Mitschuld am Sprachensterben. Rund 90 Prozent aller Webseiten im Internet sind in nur zehn Sprachen verfasst, allein 60 Prozent sind auf Englisch. Der ungarische Linguist András Kornai glaubt, dass 95 Prozent der Sprachen den Übergang ins digitale Zeitalter nicht schaffen werden.
Mansplaining auf Isländisch
Amazons Alexa horcht momentan auf acht Sprachen, Apples Siri auf etwa 25, Benutzeroberflächen etwa auf Smartphones gibt es in der Regel nur in einer Handvoll gängiger Sprachen. Sie in kaum gesprochene Sprachen zu übersetzen würde sich selten auszahlen: Schließlich kostet die Anpassung von Software ans Spanische oder Deutsche gleich viel oder weniger wie die an weniger verbreitete Sprachen.
Island investiert deshalb Millionen, um seine Sprache zu retten. Die rund 360.000 Isländerinnen und Isländer verbringen viel Zeit in einer digitalen, englischsprachigen Welt – vor allem Kinder. Eine eigene Kommission will die Sprache am Puls der Zeit halten und hat isländische Pendants zu Anglizismen wie Emoji, Podcast oder Mansplaining festgelegt, um die Wikinger-Sprache weniger antiquiert zu machen. Mit einer frei verfügbaren Datenbank will die Regierung auch Internetriesen davon überzeugen, ihre Software in Isländisch anzubieten.

Hoffnung liegt auch in der Anwendung von künstlicher Intelligenz. Noch nie war es einfacher, Sätze in Echtzeit von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Tools wie Google Übersetzer haben inzwischen einen Fixplatz in unserem Alltag eingenommen. Während Übersetzungsprogramme früher aufwendig von sprachlich kundigen Personen gecodet werden mussten, können Algorithmen nun selbst anhand tausender Textbeispiele eine Sprache erlernen.
Hoffnung NLP
Diese Fortschritte im sogenannten Natural Language Processing (NLP) will sich das Projekt Masakhane zunutze machen. Gegründet von den beiden südafrikanischen Informatikerinnen Jade Abbot und Laura Martinus arbeiten inzwischen mehr als 60 Freiwillige auf dem ganzen Kontinent daran, KI-Übersetzungsprogramme für afrikanische Sprachen zu entwickeln. Auch das im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 geförderte Embeddia-Projekt will weniger genutzte Sprachen mithilfe von NLP ins Rampenlicht rücken.
Selbst Google will den Ruf des Internets als Sprachenkiller nicht länger auf sich sitzen lassen. Die vom IT-Konzern entwickelte App Woolaroo ermöglicht das bildhafte Lernen gefährdeter Sprachen mithilfe von Bilderkennung. Hält man das Smartphone auf Objekte, zeigt die App das jeweilige Wort an – sogar mit Aussprache.
"Ich glaube nicht, dass wir die Technologie allein für den Sprachverlust verantwortlich machen können", sagt Tcherneshoff von Wikitongues. Während die Digitalisierung seit der Jahrtausendwende an Fahrt aufgenommen hat, hat sich das Sprachensterben seitdem verlangsamt. Ende der 90er-Jahre sprach man noch von einer ausgestorbenen Sprache alle 14 Tage. "Jetzt sind wir bei einer alle zwei bis drei Monate", sagt Tcherneshoff.
Die Geschichte zeigt dabei, dass Sprachen wiederauferstehen können. Myaamia, die Sprache der gleichnamigen amerikanischen Ureinwohner, galt eigentlich als ausgestorben, nachdem sie im 19. Jahrhundert mehrmals zwangsumgesiedelt wurden. In 1980ern begann sich Daryl Baldwin, selbst mit Myaamia-Wurzeln, wieder für die Sprache seiner Vorfahren zu interessieren. Er reiste durch das Land, um nach weiteren Muttersprachlerinnen zu suchen. Als er keine fand, begann er kurzerhand, die Sprache einfach allein zu lernen. Später studierte er Linguistik, um die Sprache zu rekonstruieren. Heute hat sich um ihn eine kleine Gemeinschaft gebildet, welche die Sprache am Leben hält.
Auch die kornische Sprache, die ursprünglich im Südwesten Englands gesprochen wurde, erlebte ein Revival. Eigentlich gilt die Sprache seit Ende des 18. Jahrhunderts als ausgestorben, inzwischen gibt es wieder rund 300 Menschen, die fließend Kornisch sprechen. Zurückzuführen ist das auch auf Initiativen der lokalen Regierung, die etwa Prüfungen auf Kornisch erlaubt oder zweisprachige Ortstafeln aufstellte – übrigens ohne größeres Tamtam. (Philip Pramer, 15.6.2021)