2020 war es im Ozean so still wie schon lang nicht mehr, die Wale haben sich gefreut, angeblich. Wie war das in den Städten? Vögel müssen hier generell viel lauter krähen, um trotz Straßenlärms Nestbauunterstützung zu finden. Vermutlich mussten sie im Lockdown viel weniger laut "Ich will VÖGELN!" von Ringstraßenlinde zu Ringstraßenlinde schreien, wir haben sie dabei aber viel lauter gehört – wie uns die Pandemie überhaupt dazu gezwungen hat, uns neu mit dem Hören und Sehen zu befassen.
Wie wir die Stadt erleben, hat erstaunlich viel mit dem Hören zu tun. Wenn auch anders, als wir glauben, sagt Peter Androsch, Komponist und laut Eigendefinition Schallkünstler. Er befasst sich ganz grundsätzlich mit Akustik, Raum und Gesellschaft. Was ist der erste Irrglaube? Wir vermeinen zu hören, was wir sehen. Wir hören aber viel mehr, als wir sehen: um die Ecke und, was für unser Sicherheitsempfinden am wichtigsten ist, auch den Raum hinter uns. Bis auf zehn, zwanzig Zentimeter können wir bestimmen, was wer wo tut – und sei es nur Altglas in einen Container zu werfen.
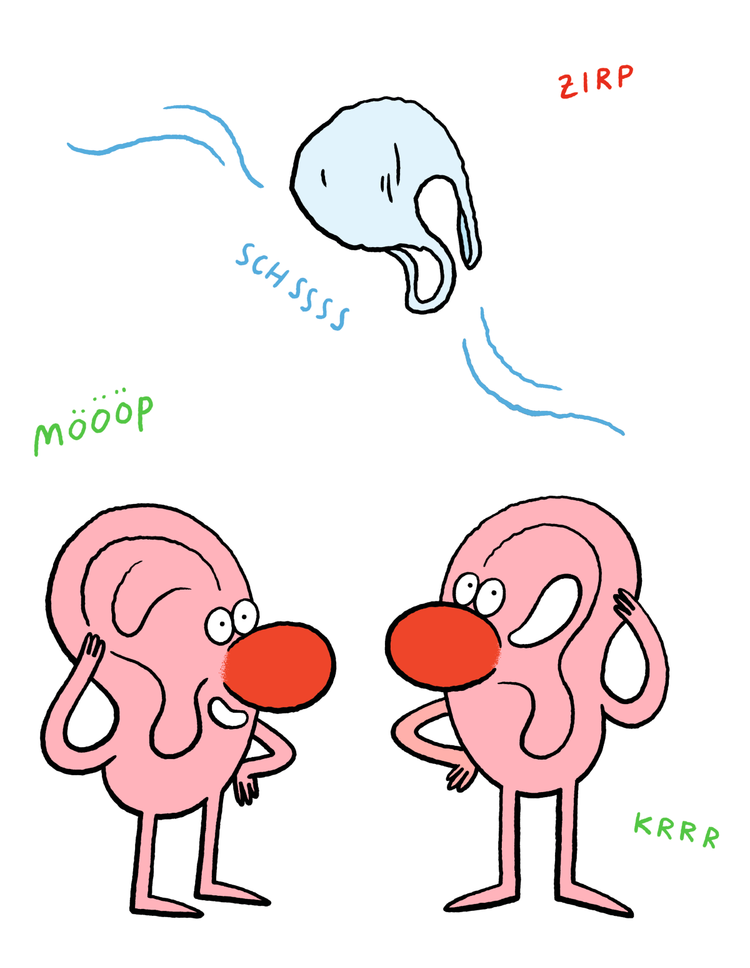
"Man kann viele Dinge hintereinander hören, wie durch Vorhänge. Das ist beim Schauen nicht so, da ist eine Mauer eine Mauer", sagt Androsch. Unser Gehirn setzt uns die Welt aus sämtlichen Sinneswahrnehmungen zusammen, baut "ein möglichst widerspruchsfreies Bild der Welt". Grundsätzlich gilt: Wir hören nicht aktiv, sobald ein Geräusch einmal als ungefährlich abgelegt ist. Denn wir hören hauptsächlich deshalb, um rechtzeitig vor Gefahren gewarnt zu werden, "das nennt man die Phylogenese, die Stammesgeschichte des Hörens", sagt Androsch. Also: Würden wir lange überlegen, ob ein Geräusch von einem uns jausnen wollenden Säbelzahntiger im Burggarten stammt, geschweige denn drauf warten, bis wir ihn sehen, wären wir schon viel zu spät dran und ziemlich sicher Säbelzahntigerfrühstück. Gestresstes. (Nein, es gibt natürlich keine Säbelzahntiger im Burggarten. Entwarnung.)
Was war nun anders beim In-die-Stadt-Hören? Wien in leise gab es vor Corona selten, eine stille Großstadt ist eben ein Widerspruch in sich. Nur beim ersten Schnee, der sich wie eine Decke über alles legt, verstummt plötzlich auch die Zweierlinie. Nachts war es draußen still, außer man hatte im Beisl den Tagesbeginn übersehen und musste bei Vogelgebrüll schnell heimlaufen, bevor es auch noch hell wurde und die Straßenbahnen vorbeirumpelten. Und am Wochenende ab 14.00 Uhr klingen generell, Weltstadt hin oder her, auch laute Wiener Ausfahrtsstraßen plötzlich nach der Vorstadt, in die sie führen.
It's oh so quiet
Während der Pandemie hat erst die völlige Stille in der Stadt die gefühlte Zombieapokalypse vollständig gemacht. Das war beängstigend. Gleichzeitig haben wir wieder gelernt, genauer hinzusehen, weil uns kein Geräusch abgelenkt hat. "Wir haben begonnen, unsere städtische Umgebung zu lesen und die Details zu hören. Es ist uns aufgefallen, jetzt höre ich zum ersten Mal das Wasser rauschen im Gully. Es gibt den Begriff der akustischen Maskierungen, wenn sich Geräusche überdecken, die fielen sehr oft weg", sagt Peter Payer. In seinem Buch Stille Stadt. Wien und die Corona-Krise dokumentiert er die Veränderungen, die von einem Tag auf den anderen über Wien hereinbrachen, auch jetzt schon ein spannendes Zeitdokument, erstaunlich viel davon hat man nach einem Jahr schon wieder vergessen.

Stille macht auch etwas mit unserem Besitzdenken in Bezug auf die Stadt: Als wir uns in ihr wieder hören konnten, hat sie plötzlich wieder uns gehört – und wir hatten Gelegenheit, darüber nachzudenken, warum sonst nicht. "Vor 100 Jahren hat dieser Verteilungskampf auch schon stattgefunden, wem gehört der öffentliche Raum, wer nimmt ihn sich, wer bekommt ihn zugeordnet. Wer ordnet so was überhaupt zu? Welche sozialen Kräfte, Schichten, Politiken, Machtverhältnisse?", sagt Payer. Androsch erklärt es mit der Theorie der akustischen Hegemonie: "Wer den akustischen Raum beherrscht, beherrscht die Gesellschaft", so einfach ist das. Sein Lieblingsbeispiel: Kirchenglocken. Auch heute hören wir sie noch dröhnen, ohne dass wir ihre Sprache von Viertelstunden und Feiertagen noch ganz verstehen. Noch so ein Beispiel von Herrschaft: durch die Gewölbe der Hofburg gehen vom Heldenplatz zum Michaelerplatz. Herrschaftsarchitektur. Jedes Geräusch, das wir machen, wird "wie ein Squashball" (Androsch) zurückgespielt. Schleichen wir dann, damit man uns nicht hört? Oder werden wir widerspenstig anarchistisch wie ein Kind und rufen Huh! und Hah!. Und pfeifen laut, hören uns doppelt im Echo und nehmen uns den Raum, wir, die wir nicht kaiserlich oder königlich sind?
Überhaupt: Welche Geräusche sind gut? Was überhaupt ist das, "laut"? Unser Empfinden davon ist historisch wie durch unsere Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen bedingt und "gelernt", jedenfalls deutlich unsachlicher, als wir annehmen.
Früher war alles – lauter!
Von wegen früher war alles besser – und leiser: Kutschen mit metallbeschlagenen Rädern klapperten über das Wiener Kopfsteinpflaster, das immer lauter wurde, je kaputter es war, es hatte nichts von der Geräuschromantik, die ein Fiaker heute bei uns auf der Prater-Hauptallee Richtung Lusthaus auslöst. In jedem Innenhof war eine Werkstatt, die Arbeit begann früh am Morgen. Leider haben wir kein Geräuschmuseum, um uns anzuhören, wie Wien geklungen hat, mit den fahrenden Händlern, die ihre Waren anpriesen vom Lavendelsträußchen bis zur Salami. Verschwunden sind das Klappern der Wasserräder entlang des Wienflusses, der ohrenbetäubende Krach von Webstühlen und Spinnereien, erzählt Payer. Zur Verkehrsberuhigung vor Adelspalästen und Spitälern wurde Holzstöckelpflaster eingesetzt. Kaum vorstellen können wir uns den Klang der Pferdestraßenbahn, "Pferde haben Waggons gezogen auf Schienen, das hat geklappert, gescheppert und gequietscht und geläutet, Glöckerlbahn hat sie geheißen, die Pferde haben viele Glöckerln umgehabt".
Der Geräuschpegel und seine Interpretation als "Lärm" war immer schon eine Klassenfrage. "Fremde" Geräusche und Stimmen werden immer erst einmal negativ empfunden. Den ersten lauten Autos wurden in Wien von den Nichtautobesitzenden Reißnägel gestreut, kaum zu glauben, heute sind es die Pop-up-Radwege, denen mit denselben Methoden begegnet wird.
Der Idealzustand der Stadt ist nämlich gar nicht Stille. Sie braucht rein planerisch auch Orte, wo ihre Bewohner laut sein können. Mit dem Anstarten des Mopeds verkünden "Ich lebe!", mit dem Handy sich eine ganz eigene Party bauen, wenn man sie nirgendwo anders feiern kann als im öffentlichen Raum, und ja, da gehört Dancing Queen von Abba auf dem Karlsplatz eben auch dazu, wie überhaupt die Mobiltelefonie zuerst und dann das Internet neue Stimmen an neue Orte brachte – sei’s im Kopfhörer als eigener Soundtrack, der uns Heldin oder Held dieser Stadt sein lässt, oder als hörbare Beziehung, Wichtigkeit oder auch nur "Ich habe das Fenster offen und ein Autoradio".
Was brauchen wir zum Leben, so als soziales Wesen? Wir müssen uns verstehen können, reden und zuhören. Oft passiert es beim Nachdenken über das Hören in der Stadt, dass Redewendungen ihre metaphorischen Metaebenen verlieren und radikal buchstäblich werden. Oder, wie Peter Androsch sagt: "Das Wesen der Demokratie ist, dass alle eine Stimme haben und gehört werden. Und wenn du wem das Maul verbietest durch schlechte Raumgestaltung, hast du auch ein demokratiepolitisches Problem."
Was passiert, wenn man Ton und Bild in der Stadt auseinanderzudröseln versucht? Herrlichstes Ohrensausen. Man hört Mauern, die es nicht gibt, Brunnenrauschen, das man nicht sieht. Wer einmal zu Fuß in die Vorstadt ging, eine Trambahnlinie entlang, hört, wie der akustische Horizont immer größer wird. Wir merken, dass die Blätter, die im Wind rauschen, uns auch dann Kühlung geben, wenn es keine gibt. Dass uns auch eine Stadtautobahn ans Meer denken lässt. Dass das nächtliche Gequake am Kaiserwasser ein Zeitsprung ist, schon so war, als es noch keine Hochhäuser hier gab, den Fröschen ist das egal. Und die Welt gehört in dem Moment uns. Und dieses Wien wird auch noch lang nach uns jemandem gehören, wenn wir keine Geräusche mehr machen, und das ist ein enorm beruhigender Gedanke. (Leben in Wien, Julia Pühringer, 15.07.2021)