Musik riechen, Farben spüren und sehen, was nicht da ist. Ein psychedelischer Rausch geht mit intensiven Sinneseindrücken und optischen Halluzinationen einher. Dieser Trip kann bewusstseinserweiternd, aber auch gefährlich sein. LSD und andere Psychedelika gelten als Hippie-Drogen – die wenigsten assoziieren sie mit der Behandlung von Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten.
Doch genau bei diesen Therapien erleben die Substanzen eine Art Renaissance. Manche Psychotherapeuten verbinden die Behandlung ihrer Patienten mit der Einnahme von LSD oder Pilzwirkstoffen – in der Hoffnung, so bessere Behandlungsergebnisse erzielen zu können. Zum Einsatz kommt zum Beispiel Psilocybin: Der aus halluzinogenen Pilzarten, den "magic mushrooms", gewonnene Wirkstoff versetzt Patienten in tagtraumähnliche Zustände samt veränderter Wahrnehmung, soll aber auch gegen Depressionen helfen.
Die Trip-Therapie
Ist die Einnahme der Drogen zu therapeutischen Zwecken zukunftsweisend für die Psychotherapie? Das glauben zumindest einige Forschende. Eine davon ist die Neuropsychologin Katrin Preller. Sie untersucht an der psychiatrischen Uniklinik Zürich den therapeutischen Einsatz von Psilocybin bei depressiven oder alkoholabhängigen Patienten. Beide Studien werden verblindet durchgeführt, erst beim Abschluss werde man wissen, welche Probanden ein Placebo erhalten haben und welche 18 bis 25 Milligramm Psilocybin. Die Probanden selbst dürften rasch wissen, was sie bekommen haben. "Es ist keine Dosis, bei man nicht mehr weiß, wo man ist, aber eine durchaus psychoaktive", sagt Preller.

Zuvor schließt das Team mittels EKG Herzkreislauf- und andere körperliche Krankheiten aus, während das Studienpersonal die Gesprächstherapie beginnt und Fragebögen ausgefüllt werden. Erst dann werden das Psilocybin und die Placebos verabreicht. Die Teilnehmer legen sich auf ein Sofa, hören Musik oder tragen Augenklappen. Zwei Therapeuten begleiten den Trip. "Wir ermutigen sie, mit dem zu gehen, was die Substanz ihnen zeigt. Es gibt Patienten, die sprechen wollen, aber auch sehr ruhige", sagt Preller. Nach etwa acht Stunden klingt die Wirkung ab. Vor und nach der Therapie wird das Gehirn mittels MRT überprüft. "Die subjektiven Effekte von LSD und Psilocybin sind ähnlich", sagt Preller, die mit dieser Substanz auch mit Kollegen aus Yale geforscht hat. Bei LSD hingegen kann die Wirkung bis zu 20 Stunden anhalten. Da Probanden bei Psilocybin schneller ausnüchtern, ist die Belastung für den Patienten und die Therapeuten, die den Trip durchgehend begleiten müssen, niedriger.
Ausbrechen aus Denkmustern
Rein chemisch wirkt Psilocybin auf unsere Serotoninrezeptoren und darauf, wie wir Emotionen verarbeiten. "Es stimuliert die Neuronen und lässt unser Gehirn Informationen anders verarbeiten." Das wisse man aus klinischen Studien mit Gesunden. "Was den klinischen Effekt ausmacht, versuchen wir noch herauszufinden", sagt Preller. Auch LSD scheint Hirnareale miteinander zu verknüpfen, die sonst nicht miteinander in Austausch stehen. Diese andere Art der Informationszusammenführung könnte dazu führen, dass Depressive und Suchtpatienten aus ihren eingefahrenen Denkmustern ausbrechen.
Eine körperliche Abhängigkeit habe man bei Halluzinogenen nicht zu fürchten, wie Studien belegen. Preller bestätigt: "Ich kenne außerdem niemanden, der einen psychedelischen Trip am nächsten Tag wiederholen will. Das ist eine emotionale und womöglich anstrengende Achterbahnfahrt." Zudem stimulieren Psychedelika die Serotoninrezeptoren so stark, dass sie sich zurückziehen. Bei der Einnahme zwei Tage hintereinander würde man keinen Effekt spüren. "Unser Körper schützt uns davor, Psychedelika täglich einzunehmen", sagt Preller. Für ihre beiden Studien musste die Neuropsychologin eine Ausnahmegenehmigung bei der Ethikkommission, der Arzneimittelbehörde und dem Bundesamt für Gesundheit beantragen. Das ist in der Schweiz, die auf eine lange Forschungstradition mit psychedelischen Substanzen zurückblickt, leichter als etwa in Deutschland.
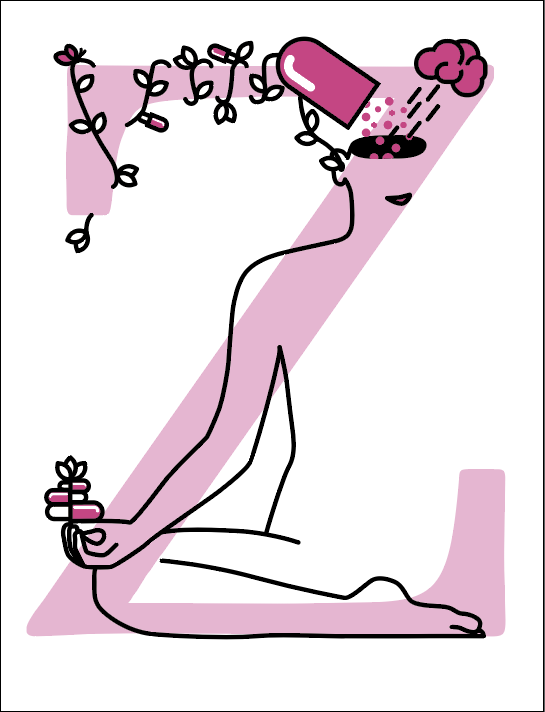
Dort führt das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim gemeinsam mit der Charité Berlin und der Mind European Foundation for Psychedelic Science aktuell die erste klinische Studie mit Psilocybin durch. Bei der EPIsoDE-Studie wird 144 Patienten mit behandlungsresistenten Depressionen ein- oder zweimal Psilocybin verabreicht. Was die Probanden während ihres Trips erleben, sollen sie in Therapiesitzungen aufarbeiten. Bei manchen stellen sich "fulminante" Veränderungen ein, sagt Gerhard Gründer, Leiter der Studie und der Abteilung für Molekulares Neuroimaging am Mannheimer Institut zum STANDARD. Allgemeine Aussagen will Gründer aber nicht treffen. "Vor Anfang 2023 werden wir keine finalen Ergebnisse haben", sagt der Psychiatrieprofessor. Psilocybin sei kein Wundermittel, das jedem Patienten hilft.
Nicht ohne Ausnahmegenehmigung
Der Wirkstoff ist im deutschen Betäubungsmittelgesetz als nicht verkehrsfähig gelistet, der Handel und die Abgabe sind verboten. Auch Gründer und sein Team mussten um Ausnahmegenehmigungen ansuchen.
In Österreich scheint es indes keine klinische Beschäftigung mit psychedelischen Stoffen zu geben. Eine Sprecherin des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) sagt: "Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden in Österreich keine klinischen Studien zu Psilocybin, MDMA oder LSD eingereicht oder genehmigt."
Studien zu Ketamin hingegen schon. Die Substanz, die viele als Partydroge oder Pferdebetäubungsmittel kennen, kann zu Wahrnehmungsstörungen führen. Anders als bei LSD oder Psilocybin kommunizieren hier nicht Hirnregionen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, sondern es fallen psychische Funktionen auseinander. Der Patient kann sich oder die Umwelt als fremd wahrnehmen.
"Wenn wir zeigen, dass die Substanzen sicher anwendbar sind, wird die Behörde gar nicht anders können, als sie zuzulassen."
Gerhard Gründer, Psychiater
Als den "Beginn einer neuen Ära" bezeichnet Siegfried Kasper Ketamin. Der emeritierte Leiter der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Med-Uni Wien erforscht dessen Einsatz bei behandlungsresistenten Depressionen, etwa als Nasenspray. Nachdem ein Drittel der Patienten mit Depressionen irgendwann ein Stadium der Resistenz erreicht und auf anerkannte Therapiemethoden nicht länger anspricht, hält der Angstforscher den Ketamin-Nasenspray für einen regelrechten "Augenöffner".
Trotzdem äußert er Bedenken. "Psychedelika zeigen Verbesserung, weil sie auf den Serotonin-2A-Rezeptor wirken." Das sei ein "neurobiologischer Effekt und eigentlich eine Nebenwirkung, die von manchen als Therapie verkauft wird", sagt Kasper. Patienten sollten aber in keine Parallelwelt verschwinden, stattdessen zähle das Hier und Jetzt gemeinsam mit den Therapeuten.
So wie Preller schließt auch die EPIsoDE-Studie Teilnehmer mit bipolaren oder anderen schweren psychischen Störungen aus. Auch solche, deren Familienangehörige ersten Grades erkrankt sind. Der Grund: Psychedelika können schizophrene Krankheiten triggern. Gründer ist jedoch zuversichtlich, dass man mit "sauberer Diagnostik Patienten mit diesen Erkrankungen ausschließen" kann.
Alternativen, keine Legalisierung
Abgesehen von den Rauschgiftexperimenten der Hippie-Ära in den 1960er- und 1970er-Jahren und den daraus resultierenden Verbote ist es wohl mit ein Grund dafür, dass etwa die deutsche Bundesregierung lange auf die Bremse gedrückt hat, statt psychedelische Stoffe als Chance für die Psychotherapie zu sehen. "Das ändert sich mittlerweile in Deutschland", sagt Gründer, der bei den Behörden zunehmend Offenheit spürt. "Wenn wir die richtigen Daten vorlegen und zeigen, dass diese Substanzen sicher anwendbar sind, wird die Behörde gar nicht anders können, als sie zuzulassen."
Nach Alternativen sehnt sich auch Preller. Sie moniert die wenigen neuen Behandlungsmöglichkeiten in der Psychotherapie und den Umstand, dass viele davon entweder Nebenwirkungen haben oder manchen Patienten nicht helfen. Dies spreche dafür, etwas neues auszuprobieren. Oder sich wieder auf die Forschungstradition der 60er-Jahre zurückzubesinnen.
Vor einer völligen Legalisierung, wie sie manche propagieren, warnt Gründer trotzdem. Dadurch könne es ähnlich wie in den 60er-Jahren wieder zu vielen Unfällen kommen, und es könnte Menschen erst recht wieder in die Psychiatrie befördern. (Allegra Mercedes Pirker, 12.9.2021)