Bereits der englische Originaltitel von Joshua Cohens Roman lautet lapidar Witz. Der US-Autor bezieht sich damit natürlich auf das Jiddische und nicht etwa auf die deutsche Sprache. Die Titelwahl lässt sich als Programm, genauso jedoch als ein gefinkeltes Täuschungsmanöver verstehen. Der Witz liegt darin, den Scherz richtig auszureizen; die Pointe dieses maßlosen, 880 Seiten langen Romans läuft auf eine Frage hinaus: Was passiert, wenn wir die Welt als eine Komödie betrachten, in der sich fast alles ins Gegenteil verkehrt?
Bild nicht mehr verfügbar.
Für Cohen ermöglicht erst der Witz, freier, vielleicht auch ungehemmter auf die jüdische Geschichte und Identität zuzugehen. Wie ein Stand-up-Comedian, der ständig die Tonlagen ändert, durchpflügt er ein Wertesystem und bringt es zum Kentern – oder auch nicht, wer weiß? Der Witz gehört sich in gewisser Hinsicht selbst. Er errichte kein System, er sei weder Konzept noch Urteil oder Argument, schrieb der Philosoph Jean-Luc Nancy einmal. Gleichwohl sei er in der Lage, all diese Rollen auf spöttische Weise zu übernehmen.
Joshua Cohens Strategie versteht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, letzthin ist sie jedoch ziemlich einleuchtend. Er versucht, das Phrasenhafte an verbürgten Auffassungen von Religion, Politik und Identität zu entlarven und dem Schicksal einen Streich zu spielen. So entsteht ein Swift’scher Gegenentwurf zu der Realität, auf die sich die meisten einigen können. Durch seine Freude an der Negation bleibt der Roman immer als Satire identifizierbar.
Kitsch von weißen Jungs
Cohen begann die Arbeit daran zu Beginn des Millenniums auch als Gegenentwurf zu einer Form von jüdisch-amerikanischem Roman, die er an Autoren wie Jonathan Safran Foer oder Michael Chabon festmachte. Das Problem der Ausrichtung ihrer Bücher sei, meinte Cohen einmal, dass sie immer mit der Aussöhnung in der Gemeinschaft enden würden.
Das Urteil des – damals ein positives Label – Querdenkers? Holocaust-Kitsch, Literatur von "weißen Jungs, die nur schrieben, weil sie gerngehabt werden wollen". Cohen indes löst das Tragische an der Geschichte in keinem wohligen Gefühlsbad auf. Er will auch nicht gefallen, höchstens auffallen mit seiner sprachlichen Virtuosität.
Der Roman hat einen bemerkenswert dystopischen Ausgangspunkt, aus dem sich dann alles Weitere ableitet. Am Weihnachtsabend des Jahres 1999 sterben alle Juden in den Vereinigten Staaten mit der Ausnahme der männlichen Erstgeborenen. Bibelfeste (und Zehn Gebote-Kenner) wissen freilich, dass Cohen hier auf die zehnte Plage verweist, welche eigentlich die Ägypter traf.
Über die Hintergründe kann nur gerätselt werden, niemand fragt, Antworten gibt es zuhauf. Keine davon hält. "Ein Gen, ein Genom, was eine Gemeinde von Genen ist – eine Gemeinschaft ihrer Genome, sagen wir, ein Jnom", lautet eine davon. Die Sache gleicht einer Heimsuchung, die ohne Vorzeichen einsetzt, mit dem Weihnachtsmann als Todesengel. Weder das Wort Jude noch Judentum werden in Witz übrigens je genannt und damit auch keiner der Pogrome, die Juden erleiden mussten.
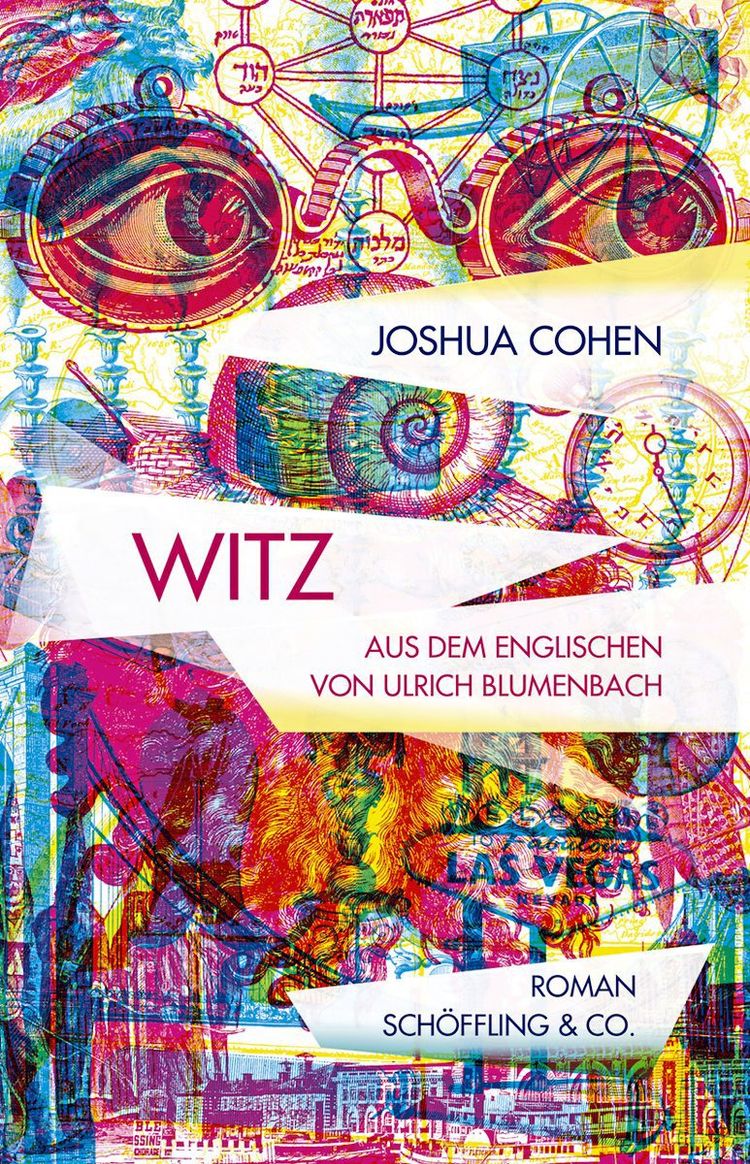
Alternativuniversum
Cohen erschafft ein Alternativuniversum, ähnlich verquer wie Martin Amis’ Pfeil der Zeit: oder Die Natur der Straftat, ein Roman, der die NS-Vernichtungsmaschine rückwärts erzählt hat und zur Lebensquelle verkehrte. Bei Cohen werden die Überlebenden auf Ellis Island in einem Lager untergebracht. Das kann die zweite Katastrophe nicht verhindern, denn als im Frühjahr das Pessachfest ansteht, sterben auch die Erstgeborenen. Cohen zählt die Geschehnisse wie bei einem Kinderreim herunter, der keine Abweichungen duldet.
Die zentrale Pointe des Romans liegt in der Figur des unwilligen Messias, dem letzten Juden, der nach diesem doppelten Fiasko übrig bleibt. Er heißt Benjamin Israel und wird eine Woche vor dem großen Sterben geboren, und zwar als fertiges Idol, komplett mit Brille, Bartwuchs und sogar bereits beschnitten.
In einem Land, das der Angst anheimfällt, seinen Draht zu Gott zu verlieren, und deshalb seine Bevölkerung zur Annahme der ausgelöschten Tradition zwingt, kommt Ben, dem Auserwählten, eine privilegierte Stellung zu. Das muss natürlich vermarktet werden. Cohens spöttische Fantasie lässt die wunderlichsten Blüten sprießen: Benjamin (oder Ben) wird zum Hype und wird nach allen kapitalistischen Regeln der Kunst ausgebeutet.
Als guter Schüler von Thomas Pynchon und David Foster Wallace scheut Cohen auch keine billigen Scherze, er mischt Heilslehre mit Elementen der Schmierenkomödie: Selbst Bens hartnäckig nachwachsende und dann wieder abschuppende Vorhaut soll zum Medienspektakel erhoben werden ("Gewebereparatur als Metapher des Überlebens").
Der US-Präsident will noch näher heran, indem er den Auserwählten sogar mit seiner Tochter verkuppelt. Dabei erweist sich der Letzte seines "Stammes" nur als mäßig inspirierter Verwalter des eigenen Erbes: "Die Welt hat den Verstand verloren. Jeder will ich sein, bis auf mich." Ben wird benützt, um den Massen die Idee der Erlösung schmackhaft zu machen, bleibt selbst jedoch völlig desinteressiert am Judentum und jeder Form religiöser Praxis.
Dr. Froid und sein Begehr
Cohen entwirft Ben als im Grunde hohle Figur, als Meister der "Schlemielundschlimasigkeit", der selbst noch Wasser in verdorbenen Wein zu verwandeln vermag. So unmotiviert der Held auch ist, die pikaresken Stationen seiner Reise werden detailversessen ausstaffiert. Von seinem Großvater in Florida gelangt Ben in den Westen, nach Los Siegeles – ein Verweis auf den jüdischen Gangster Bugsy Siegel – und Holywood (sic!). Dort kommt es zu einer Begegnung mit Dr. Froid (sic!), einem Außerirdischen mit vier Penissen, der sich als Gesandter von Zion erweist und nicht altern kann; und deshalb besessen von allem ist, das zu Ende gehen kann.
Noch das surrealste Geschehen wird, wie man erkennen kann, von Cohen mit Verweisen auf das Judentum gespickt. Zurück im Elternhaus seiner Familie in New Jersey erlebt Ben schließlich seine sexuelle Offenbarung beim Cunnilingus mit seiner Ersatzmutter, bei dem ihm die Zunge herausgerissen wird. Irgendwann erträgt Ben sein Los nicht mehr und versucht, nach Europa zu fliehen.
Doch Polen ist zu "Polenland" geworden, ein von den USA betriebener Themenpark, der als verkehrter Holocaust dient. Hierhin, nach Wasimmerwitz, werden alle hingebracht, die sich geweigert haben zu konvertieren. Bei aller Freude an den Möglichkeiten des Schelmenromans verliert Cohen seinen Sinn für menschliche Grausamkeiten nicht.
Überschwang
Stilistisch justiert er ständig nach. Es finden sich wuchtige Passagen, in denen sich lyrisches Fabulieren mit diskursiven Elementen mischt, wobei man bisweilen den Eindruck bekommt, die Sätze kommen gar nicht nach; dann nähert er sich abstrusen Ereignissen wieder so realistisch an, als würde er fantastische Tableaus beschreiben.
Am Ende folgt ein dreißig Seiten langer innerer Monolog eines Holocaustüberlebenden ohne Punkt und Komma. Ulrich Blumenbach, der schon Foster Wallace ins Deutsche übertrug, hat mit der Übersetzung auf bravouröse Weise eine Herkulesaufgabe gestemmt: nicht nur aufgrund der jüdischen Verweise, auch wegen all der Jargons, Neologismen und Referenzen.
Cohen hat Witz im Alter von dreißig Jahren publiziert, das erklärt manchen Überschwang. Man geht leicht unter darin, weil es keine erzählerische Autorität gibt, die Rettungsreifen auswirft. Dass das Buch in der Rezeption als der jüdischer Ulysses bezeichnet wurde, darüber macht sich Cohen inzwischen selbst schon lustig: Das Problem daran sei, dass schon Joyce’ Ulysses der jüdische Ulysses sei.
In einem jüngeren Interview in der Paris Review verteidigt er aber die Idee eines Romans, der sich nicht preisgibt. Da findet sich der großartige Satz, dass erst das Auffinden dessen, was in einem Buch fehlt, uns, also die Lesenden, ganz, komplett machen würde.
Clash der Professoren
In seinem Roman The Netanyahus, der vergangenes Jahr in den USA erschienen ist, widmet sich Cohen noch einmal aus einem anderen Blickwinkel der Aufgabe des jüdisch-amerikanischen Romans und damit auch jener der Veränderung jüdischer Kultur.
Die Perspektive ist die des jüdischen Geschichtsprofessors (nicht aber Professor für Judentum!) Ruben Blum, der von seinen Universitätskollegen immer wieder an seine kulturelle Herkunft erinnert wird, der er selbst, liberal, assimiliert, entkommen wollte, die er zumindest nicht als oberste Priorität sieht.
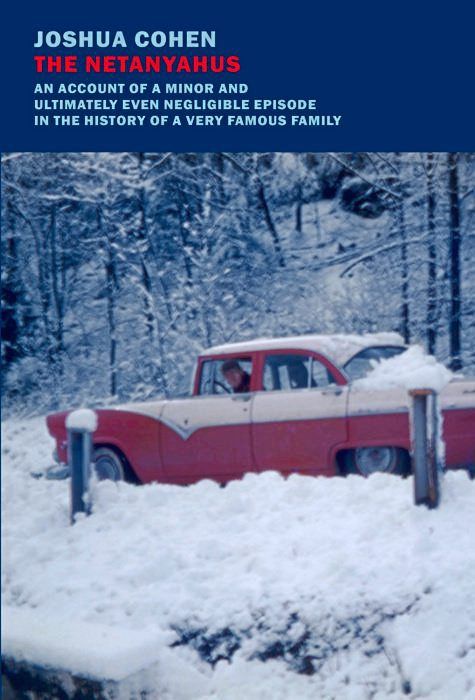
Es ist das Jahr 1960, wohlgemerkt, die erbittert geführten Debatten um Identitätspolitik der Gegenwart sind noch fern. Doch Cohen hat diese bereits im Visier, wenn er Benzion Netanyahu und "die ganze mishpocha" als rhetorisch aufgerüstete, wilde Horde antreten lässt und eine in jeder Hinsicht überhitzte und hochkomische Konfrontation zwischen amerikanischem und israelischem Jüdischsein inszeniert.
Im Vater des späteren israelischen Premiers, einem Historiker, der sich an der Universität bewirbt, hat der so universalistisch denkende Blum einen Vertreter des revolutionären Zionismus vor sich, dessen essenzialistische Betrachtung des Judentums ihm – und natürlich auch Cohen – missfallen muss.
Im direkten Vergleich zu Witz wirkt The Netanyahus wohl auch deshalb so diszipliniert und sorgfältig komponiert, weil er wie als Pastiche von Autoren wie Philip Roth und Saul Bellow geschrieben ist, als ironische Hommage auf eine versiegende Ära. Auf der Metaebene – und das verbindet die Bücher wieder – ist aber auch dies der Versuch, Fiktion gegen die Vorstellung einer exklusiven Gemeinschaft in Stellung zu bringen, die sich im Besitz der Wahrheit glaubt. Blum sieht in Netanyahu den "touring public relationist", der in seinem Vortrag schon den Zerfall Amerikas in identitäre Minoritäten voraussieht – wogegen nur die "safe zone" Israel hilft.
In Witz ist diese Idee des beharrlichen Rückzugs schon verwirklicht, aber eben andersherum. Der Zwang zur Assimilierung ist ein Zerrspiegel für eine Gemeinschaft, die sich in sich verschließt. Cohens Ironie besteht jedoch darin, dass das Jüdischsein in einem Roman, in dem die Juden selbst verschwinden, in jedes Sprachdetail einsickert und damit in der Fiktion wiederkehrt. (Dominik Kamalzadeh, ALBUM, 27.1.2022)