Als die damalige deutsche Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Herbst 2020 einen neuen Entwurf des Insolvenzrechtes präsentierte, hätte das normalerweise bis auf eine kleine Gruppe spezialisierter Juristinnen und Juristen wohl niemanden sonderlich interessiert.
Was für Aufregung sorgte, war aber nicht der Inhalt, sondern der Text selbst: Denn in den 247 Seiten des unaufregend klingenden "Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts" waren fast durchgehend weibliche Bezeichnungen zu lesen.
Aus Gläubigern wurden Gläubigerinnen, aus Schuldnern Schuldnerinnen. Mehr als 600-mal wurde in dem Text das sogenannte generische Femininum verwendet. Das heißt: Männer sind mitgemeint.
Bundeskanzler und Landeshauptmann
Bisher war es vor allem umgekehrt. Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz spricht etwa nur vom Staatsbürger, vom Bundeskanzler und von Landeshauptmännern. Während in vielen anderen Bereichen bereits mit Sonderzeichen, etwa dem Stern oder Doppelpunkt, gegendert wird oder sowohl männliche und weibliche Form genannt werden, ist in Gesetzestexten immer noch häufig nur die männliche Form zu lesen.
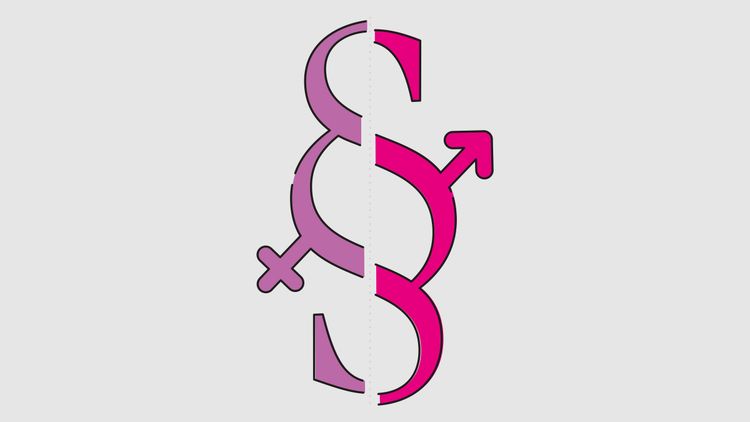
Eines der Hauptargumente der Befürworterinnen und Befürworter des Genderns ist, dass Sprache die Wahrnehmung der Lesenden prägt: Studien haben gezeigt, dass das mit dem "Mitmeinen" in der Regel eher schlecht als recht funktioniert. Menschen denken, wenn sie die männliche Form lesen, vor allem an Männer.
Geschlechtergerechte Sprache soll das ändern – und Frauen mithilfe von Sprache sichtbarer machen. Auch wenn die Debatte vielen noch als Reizthema gilt, hat sich das Gendern vielerorts durchgesetzt. Wäre es nicht da nicht konsequent, geschlechtergerechte Sprache auch in Gesetzen umzusetzen?
Nicht einheitlich
In Österreich erwähnt bereits das bundeseigene Handbuch der Rechtssetzungstechnik aus dem Jahr 1990, dass "Formulierungen so zu wählen sind, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen". In der bisherigen Praxis wird auch bereits gegendert, heißt es aus dem Justizministerium, und zwar meist durch die Verwendung neutraler Begriffe, etwa "die betroffene Person" statt "der Betroffene" oder die Verwendung der Paarform, also indem sowohl die männliche als auch die weibliche Form genannt werden. In allen nichtlegistischen Bereichen, etwa auf Websites oder Broschüren, komme der Binnendoppelpunkt zum Einsatz.
Ganz einheitlich und konsequent wird die geschlechterneutrale Sprache in Österreich allerdings noch nicht verwendet. So ist in der am Mittwoch veröffentlichten aktuellen Corona-Verordnung nur noch von Seilbahnbetreibern und Veranstaltungsteilnehmern die Rede, während in früheren Verordnungen noch die Paarform verwendet wurde.
Neben Zeitdruck könnte auch ein anderer Grund ausschlaggeben gewesen sein: Als Nachteil von geschlechterneutraler Sprache gilt gemeinhin, und das ist wiederum eines der Hauptargumente ihrer Gegnerinnen und Gegner, dass sie als schwieriger verständlich wahrgenommen wird.
Symbolische Wirkung
Das gibt auch der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt auf STANDARD-Nachfrage zu. "Paarformen sind zweifellos nicht geeignet, die Lesbarkeit von Rechtsvorschriften zu erhöhen", heißt es von dort. Außerdem würden sie Verordnungen und Gesetze in die Länge ziehen und damit die Auffindbarkeit von Bestimmungen erschweren.
Mit der Verfassung sei die Paarform hingegen vereinbar, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Ob nun beide Geschlechter oder – wie früher – nur die männliche genannt wird, ist zumindest juristisch unerheblich. Es geht um die reine Symbolik.
Um die Symbolik dürfte es wohl damals auch der deutschen Justizministerin Lamprecht gegangen sein, als sie den Gesetzesentwurf im generischen Femininum eingebracht hat.
Schließlich machte das Innenministerium der Idee den Garaus. "Nach Ansicht des Verfassungsministeriums hat das bei formaler Betrachtung zur Folge, dass das Gesetz möglicherweise nur für Frauen oder Menschen weiblichen Geschlechts gilt – und damit möglicherweise verfassungswidrig ist", erklärte ein Ministeriumssprecher der Süddeutschen Zeitung. Im Endeffekt wurde das Insolvenzgesetz also in ausschließlich männlicher Form abgefasst – wie es in Deutschland üblich ist.
Generisches Femininum
In Österreich gab es die Debatte um das generische Femininum in Gesetzestexten in dieser Form bisher nicht. Das Justizministerium sieht jedenfalls keine verfassungsrechtlichen Bedenken, würde man ab sofort nur noch die weibliche Form in Gesetzen nennen.
Der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt sieht diese Frage hingegen rechtlich als "ungeklärt" an. "Ganz offensichtlich" sei hingegen, dass es weder geschlechtergerecht noch inklusiv sei, wieder nur ein Geschlecht zu nennen. (pp, 29.3.2022)