Über die Scham, die vor allem pubertierende Kinder für ihre Eltern empfinden, wird gerne gescherzt. Dass aber auch Eltern sich für ihre Kinder schämen können, wird seltener thematisiert – wohl auch, weil es zumeist wesentlich mehr Leid bedeutet.
Zum Beispiel wenn, wie in Kim Hye-jins Roman Die Tochter, eine Familie, bestehend nur noch aus Mutter und erwachsenem Kind, in einer Gesellschaft lebt, die überdurchschnittlich viel Wert auf Tradition und Konformität legt. Und das eigene Kind, die titelgebende Tochter, homosexuell ist.

ist das Debüt der 1983 geborenen Südkoreanerin, die für ihr Buch dort vielfach schon ausgezeichnet wurde.
Es ist der erste Roman der 1983 in Daegu geborenen Südkoreanerin Kim Hye-jin, der nun, übersetzt von Ki-Hyang Lee, auf Deutsch erschienen ist. In Südkorea wurde die Autorin bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2020 mit dem renommierten Daesan-Literaturpreis.
Existenzielle Bedrohung
Die Tochter wird nun vielen deutschsprachigen Leserinnen, zumindest jenen, die in einem eher aufgeklärten Milieu aufgewachsen sind, ein wenig fremd erscheinen: nicht nur der förmliche, fast eilfertige Tonfall der Mutter, die als Ich-Erzählerin auftritt. Sondern vor allem das existenzielle Ausmaß an Bedrohung, das es für sie bedeutet, als ihre Tochter aufgrund ihrer offenen Homosexualität nicht mehr ihrer Tätigkeit als Universitätsdozentin nachgehen darf und mit ihrer Lebensgefährtin bei der Mutter einzieht.
Sie und "das Mädchen", wie die Mutter sie stur nennt, sind Teil einer Protestbewegung, die dafür kämpft, dass die Universität nicht länger Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung de facto ein Berufsverbot erteilt.
Dabei hätte der Mutter die Homosexualität alleine schon gereicht: Sie träumte von einem geordneten Leben mit Mann und Kind für ihre Tochter. Als Pflegerin in einem Altenheim kümmert sie sich um Tsen, eine ehemals berühmte Wohltäterin, die zahlreiche benachteiligte Kinder bei ihrem Start ins Leben unterstützte.
Brüchige Vorstellung
Diese Tsen (die ihre Pflegerin bezeichnenderweise "Mama" nennt) erscheint der Mutter nun als Menetekel: Wie wird es ihrer Tochter wohl ergehen, wenn sie sich immer nur für andere einsetzt (denn so sieht es die Mutter), statt sich selbst eine Familie aufzubauen, die sie einmal versorgt? "Das Mädchen" jedenfalls, so viel macht sie dem jungen Paar mehr als deutlich, zählt nicht als Familie.
Etwas didaktisch und wenig subtil wirft Kim Hye-jin die Frage auf, wohin eine Solidarität und gesellschaftliches Engagement führen, ob sie sich "lohnen" oder ob man nicht besser für die eigene Zukunft vorsorgen sollte.
Wie brüchig diese althergebrachte Vorstellung von Daseinsvorsorge und emotionaler Absicherung durch Familiengründung ist und schon immer war, zeigt nichtsdestoweniger das Beispiel der Mutter selbst: Der Mann ist bereits verstorben, sie muss, obwohl selbst nicht mehr die Jüngste und körperlich in einem desolaten Zustand, die anstrengende Arbeit als Pflegerin ausüben. Und auch die Tochter erfüllt nicht die Erwartungen, weder im privaten noch im beruflichen Bereich. Dabei ist der Mutter durchaus bewusst, dass der Fehler im System liegt – nicht bei ihrer Tochter.
Kein kitschiges Happy End
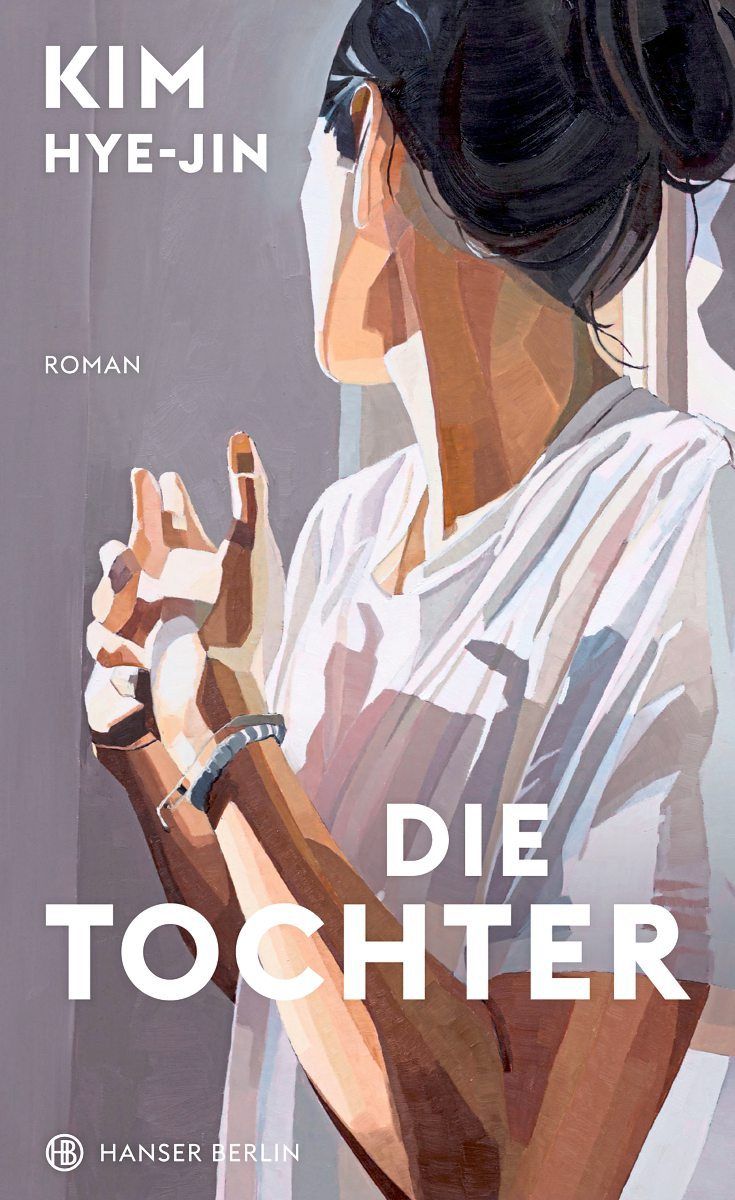
Immer wieder fletscht ein entfesselter Neoliberalismus auf den Seiten seine Zähne: Die Tochter hatte kein festes Anstellungsverhältnis, früher "ging es einem von zehn Leuten so, später dreien von zehn. Nach und nach stieg der Anteil und liegt nun bei sechzig bis siebzig Prozent." Im Pflegeheim reichen Hygiene- und Pflegeprodukte nicht aus, die Windeln müssen zerschnitten und mehrfach verwendet werden. Es liest sich wie eine düstere Vision dessen, was westlichen Ländern bevorsteht, wenn sie so weiterwirtschaften wie bisher.
So deprimierend das Bild ist, das Kim Hye-jin über weite Strecken des Buches zeichnet, gibt es dennoch so etwas wie Hoffnung. Kein kitschiges Happy End, sondern ein nüchternes, das mehr mit Sich-Arrangieren und Pragmatismus zu tun hat als mit großen Utopien. Insofern also: ein realistisches.
Ganz ohne Mann und Kind
Die Mutter, die sich doch jeden Impuls von Aufbegehren und Engagement abtrainiert zu haben scheint, öffnet sich und beginnt, wider alle Vernunft, sich für andere Menschen einzusetzen.
Und plötzlich zeigt sich, was die meisten von uns hoffentlich schon vorher wussten: dass man auch ohne heteronormative Familie, sogar gänzlich ohne Mann und Kind, nicht zwingend allein sterben muss. Und dass es in all dem Elend des vergänglichen irdischen Daseins, das Kim Hye-jin uns derart schonungslos vor Augen führt, doch so etwas wie Trost und Gemeinschaft gibt. (Andrea Heinz, ALBUM, 7.5.2022)