
Für das Gespräch mit Frank Witzel war schon ein Termin fixiert, es sollte persönlich in Berlin stattfinden. Doch dann fuhr der Teufel der Schreibtischarbeiter dem Journalisten in die Hüfte, und als es wenige Tage später dann doch zu dem Zusammentreffen kam, dieses Mal via Skype, da wusste auch Frank Witzel gleich eine Menge von Osteopathie und von den Grenzen der Selbstbeobachtung im Schmerz zu erzählen. Das Schreiben hilft ihm, so Witzel, aus gewissen Zuständen hinauszukommen, von einem Bandscheibenvorfall kann man sich allerdings nicht freischreiben, wie er pointiert einräumte. So entstand ein Dialog, der zwischen Offenbach und Berlin seine Form fand. Witzel pendelt zwischen diesen Städten, im Zug kann er Interviews gut redigieren.
Standard: Herr Witzel, Sie wollen beim Literaricum in Lech über das Absurde sprechen. Dem soll nicht vorgegriffen werden ...
Witzel: Was ich in Lech zusammen mit Katharina Teutsch besprechen werde, ist kein Geheimnis. Zum Teil weiß ich es selbst noch nicht einmal, weil es sich aus dem Moment ergeben wird. Jedenfalls kann man das nicht spoilern wie eine Netflix-Folge.
Standard: Mit einem Spoiler-Alarm muss man sich bei Ihnen tatsächlich nicht aufhalten. Nehmen wir aber doch einen kleinen Umweg, vom Absurden zum Wahnsinn. Der spielt eine große Rolle in Ihrem jüngsten Buch, das mir ziemlich radikal vorkommt. "Erhoffte Hoffnungslosigkeit. Metaphysisches Tagebuch II". Da nehmen Sie alles auseinander und setzen es nicht vollständig wieder zusammen.
Witzel: Es ist ein Denktagebuch, ein Beobachtungsbuch meines Geistes. Im Nachhinein füge ich nichts hinzu, die Gedanken sollen in ihrer Entstehung festgehalten werden. Das Persönliche ist eher zurückgenommen. Ich offenbare mich aber mit durchaus eigenartigen Zuständen und Verunsicherungen. Etwa mit der Frage: "Stehe ich am Rande des Wahnsinns?" Dann beruhigt es mich, wenn ich das schon einmal formulieren kann. Am Anfang steht häufig eine körperliche Verfassung, die ich in Gedanken zu überführen versuche, sodass ich mich aus gewissen Zuständen heraus- und in den Tag hineinretten kann. Das heißt, es geht in den Tagebüchern immer um etwas. Ich denke nicht in einem luftleeren Raum, sondern von einer konkreten Befindlichkeit aus. Ich bin eigentlich kein Tagebuchschreiber, aber damals, beim ersten metaphysischen Tagebuch (Uneigentliche Verzweiflung, 2019), war ich in einer Schreib- und auch sonstigen Krise und habe, auch wenn das paradox klingen mag, darauf mit täglichem Schreiben reagiert. Den Titel habe ich von dem Philosophen Gabriel Marcel übernommen.
Standard: Absurd könnten Ihre Versuche erscheinen, Kategorien wie Raum und Zeit hinter sich zu lassen. Ein Leben ohne Apriori. Ein Leben ohne Sprache? Die Sprache ist nicht das Haus des Seins, sondern das Gefängnis des Seins, wie Sie es in "Erhoffte Hoffnungslosigkeit" zuspitzen.
Witzel: Genau, allerdings müsste man an dieser Stelle den Begriff "Gefängnis" definieren. Letztlich sind wir ja alle in dieser Welt gefangen. Aber ein Großteil dieser Welt besteht nun einmal aus sprachlichen Konstruktionen. Deshalb interessieren mich auch Zustände, wie etwa die Meditation, die über die Sprache hinausführen, auch wenn man dann wieder zur Sprache zurückkehren muss, um gewonnene Erfahrungen übermitteln zu können. Wichtig ist allerdings das Bewusstsein, dass man immer durch ein eingeschränktes Fenster auf die Welt sieht. Gerade weil die Sprache so ungeheuer viel ermöglicht, muss ich mir immer wieder ihre Grenzen in Erinnerung rufen. Wittgenstein bedeutet mir in dieser Beziehung sehr viel, weil er die Sprache radikal auf die Probe stellt. Man kann ja nicht genau trennen, wo ein Gedanke aufhört und die Sprache anfängt. Deshalb entschließe ich mich manchmal ganz bewusst, gewisse Dinge, etwa Träume, nicht aufzuschreiben, weil ich sie nicht in ein Narrativ pressen möchte. Diese Ambivalenz zwischen Sprache und Schweigen, zwischen Aufschreiben und Erleben ist mir sehr bewusst, gerade wenn ich sie im Schreiben behandle.
Standard: Sie wurden 2015 durch den Buchpreis für den Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" berühmt. Hat Ihnen dieses Buch die Freiheit beschert, dass Sie sich nun literarisch-philosophisch mit Grenzerfahrungen der Sprache auseinandersetzen können? Hat der Erfolg den Philosophen in Ihnen geweckt?
Witzel: Ich war Ende 50, als ein gewisser Erfolg eingetreten ist. Angefangen zu schreiben hatte ich schon Jahrzehnte davor, schließlich kam mein erster Gedichtband bereits 1978, da war ich 22, heraus. Ich wollte dann von der Lyrik zur Prosa und habe mich zurückgezogen und für mich geschrieben. Das habe ich wohl ein wenig übertrieben, denn ich habe damals den Anschluss zur Literaturszene weitgehend verloren. Ab 2001 habe ich drei Romane veröffentlicht, die allerdings wenig Erfolg hatten. Der Buchpreis hat mich dann in die Öffentlichkeit gerückt. An dem Buch, für das ich ihn bekam, hatte ich viele Jahre gearbeitet. Beschäftigt hatte mich vor allem die Suche nach einer Form. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich verschiedene Erzählstimmen und Erzählstrukturen zusammenführen kann, bis ich irgendwann bemerkt habe, dass meine Stimme aus einer Mehrstimmigkeit besteht. Deshalb war dieser Preis eine besondere Belohnung.
Standard: Sie haben einmal bemerkt, dass Sie im Grunde eher für Berufsleser schreiben und auch selbst einer sind. Der Bestseller war diesbezüglich eine Ausnahme, insgesamt sind Sie aber eindeutig ein Autor der Autoren. Wie hält man dieses vermutlich auch einsame Leben mit der Literatur so lange durch? Gab es da ein Ursprungserlebnis?
Witzel: Die Energie kam immer aus der Literatur selbst. Ich wollte mich schon sehr früh einschreiben in diese Literatur, die mich so fasziniert und begeistert hat. Ich war zwölf oder dreizehn, da habe ich Peter Handke entdeckt mit Romanen wie Die Hornissen oder Der Hausierer. Ich habe kein Wort verstanden, aber genau das hat mich fasziniert. Literatur hatte da beinahe etwas Religiöses: Umgang mit dem, was ich gerade nicht verstehe, nicht auflösen kann. Dann kam die Popmusik dazu, bei der ich immer auch sehr stark auf Texte geachtet habe, das führte dann zu Gedichten wie Das Geheul von Ginsberg, da habe ich schon ein bisschen mehr verstanden. Es war die Literatur, die mich am Schreiben gehalten hat, denn wenn ich auch kein Publikum hatte, so fühlte ich mich in ihr aufgehoben.
Standard: Haben Sie manchmal den Verdacht, Sie könnten zu viel für die Literatur gelebt haben?
Witzel: Das ist ja nur ein Ausschnitt, der meinen Beruf betrifft. Natürlich gibt es ja auch ein anderes Leben mit Beziehungen, Freunden und Familie. Aber wenn Sie mich so fragen, dann habe ich schon sehr früh eine Priorität gesetzt: Ich wollte immer Zeit haben für das Schreiben. Lange Jahre habe ich von Gitarrenunterricht und zeitweise durchaus prekär gelebt, allerdings hatte ich Zeit – Zeit zum Schreiben. Aber gerade die Beziehung zu anderen Menschen spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, da bin ich kein Thomas Mann, den man zwischen zwölf und sechzehn Uhr nicht stören darf. Dennoch versuche ich, so bald wie möglich ins Schreiben zurückzukommen. Ich sehe Bartleby von Melville, über den wir in Lech sprechen werden, auch als jemanden, der bewusst verzichtet.


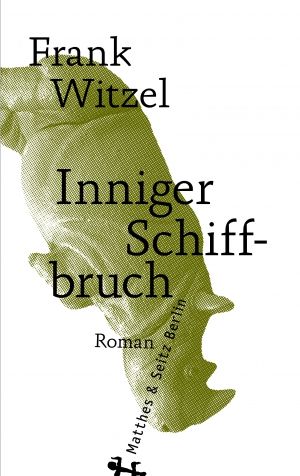

Standard: Heute kämpfen fast alle mit der Zeit. Haben Sie Techniken, die Ihnen dabei helfen?
Witzel: Ich habe schon früher mit der Schreibmaschine geschrieben, weil das schneller ging als mit der Hand, und auch jetzt schreibe ich am Computer. Allerdings habe ich in den vergangenen Jahren immer mehr das Schreiben mit der Hand entdeckt. Es gibt da tatsächlich eine Entwicklung bei mir zum langsameren Schreiben.
Standard: Wie halten Sie es mit Humor und Ironie? "Die Erfindung" könnte man als Popliteratur bezeichnen, allerdings hat sich deren schale Ironie doch erschöpft.
Witzel: Für mich ist die Ironie sehr wichtig als Form der Negation, wie sie die Romantik entwickelt oder auch Kierkegaard benutzt hat. Ironie ist für mich vor allem Selbstironie. Diese schlaffe Ironie, etwas zu sagen, das man nicht so meint, um den anderen an der Nase herumzuführen oder jemanden bloßzustellen, wenn er darauf hereinfällt, interessiert mich nicht. Wenn, dann geht es darum, sich selbst an der Nase herumzuführen, gerade auch bei den Dingen, die man ernst meint, bei denen es um etwas Existenzielles geht. Das ist eine tatsächliche Herausforderung, der ich mich immer wieder stelle.
Standard: Literaturbetrieb und Publikum interessiert wohl vor allem eine Frage: Werden Sie noch einmal etwas schreiben wie "Die Erfindung"? Einen großen, sprachvergnügten, erinnerungssatten Roman?
Witzel: Es kommt bestimmt noch ein Roman. Ich habe sehr lange an der Erfindung gearbeitet, weil ich auch hier sehr lange nach einer bestimmten Form gesucht habe. Dann kam der Roman Direkt danach und kurz davor, der hat sich innerhalb eines Jahres mit einer doch eher verspielt ausufernden Form Bahn gebrochen, nachdem ich ein Jahr nicht zum Schreiben gekommen war. Der jüngste Roman Inniger Schiffbruch entstand dann aus dem konkreten Anlass, mich nach dem Tod meiner Eltern noch einmal abschließend mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Es wird, wenn nichts dazwischenkommt und mir noch etwas Zeit bleibt, bestimmt weitere Romane von mir geben. Zurzeit beschäftige ich mich allerdings mit Erzählungen. Die kleinere Form ist für mich eine Herausforderung, weil ich immer der Versuchung standhalten muss, die einzelnen Geschichten nicht doch noch zu einem Roman zusammenzufügen.
Standard: Versuchen Sie womöglich, alle Formen in Ihrem Werk unterzubringen?
Witzel: Es geht mir selten um die Form an sich, allerdings stellt sich beim Schreiben immer wieder heraus, wie wichtig die Form ist, vor allem, dass sie nicht etwas ist, das vom Inhalt zu trennen wäre. Die Form gibt mir einen Rahmen, gleichzeitig versuche ich diesen Rahmen zu sprengen oder, weniger negativ gesagt, zu erweitern. Einerseits brauche ich die Form und denke auch immer wieder über sie nach. Dann gibt es aber etwas anderes in mir, das sich gegen die Form auflehnt. Diese beiden Tendenzen versuche ich im Schreiben zu versöhnen.
Standard: Dürfen wir uns den Schriftsteller Frank Witzel als einen glücklichen Menschen vorstellen? Weil er es geschafft hat, sein Leben mit der Literatur zum Beruf zu machen?
Witzel: Ja, ich bin, was das angeht, recht glücklich. Ich weiß allerdings genau, dass ich das auch schon war, als der Roman Die Erfindung im Frühjahr 2015 endlich erschien und ich noch nicht wusste, was daraus werden wird. Ich hatte damals schon etwas bessere Einkommensmöglichkeiten, und doch dachte ich in den Wochen vor dem Buchpreis, ich muss mich jetzt wieder um einen "Brotjob" kümmern. Dass ich das nicht mehr muss und mich ganz dem Schreiben widmen kann, darüber freue ich mich jeden Tag. (Interview: Bert Rebhandl, 10.7.2022)