Im Gastblog zeigt Tobias Goretzki, wie man das Gehirn dazu animieren kann, sich bestmöglich Wissen anzueignen.
Warum ist Lernen eigentlich immer so schwierig, wenn man es muss? Warum kann man sich manchen Lernstoff auch nach dem zwanzigsten Mal durchlesen nicht merken, aber bestimmte Ereignisse im Leben behält man langfristig fast absurd detailliert im Gedächtnis? Warum will man sich gewisse Sachen wirklich aneignen, investiert Zeit und Energie, hat aber das Gefühl, dass man stagniert oder kaum vorankommt? Warum ist man vermeintlich schlecht in Mathe? Eine Antwort darauf findet sich in der Funktionsweise des Gehirns!
Funktionsweise des Gehirns
Ein Verständnis unseres Gehirns und seiner Funktionsweise ist unerlässlich, wenn es um Lernen oder Lehren geht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sollten somit sowohl im Schulunterricht als auch beim autodidaktischen Lernen für effektiven Erfolg implementiert werden.
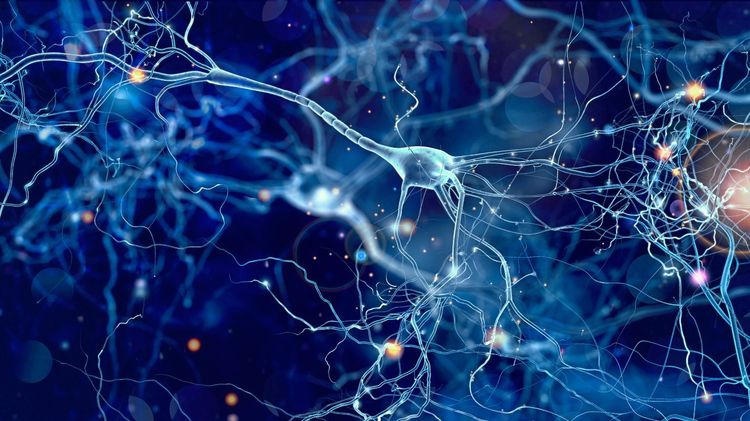
Unser Gehirn bezieht ungefähr 20 Prozent unseres Energie- und Sauerstoffbedarfs und besteht im Durchschnitt aus 100 Milliarden Zellen, die man Neuronen nennt. Dabei sind einzelne Neuronen mit bis zu jeweils 10.000 anderen Neuronen über Synapsen verbunden, mittels derer elektrische Impulse und chemische Signale gesendet und empfangen werden können.
Je öfter spezifische Neuronen miteinander kommunizieren, desto stärker wird ihre neuronale Verbindung – je seltener, desto schwächer. Dieses Phänomen wird als Neuroplastizität bezeichnet, bei der sich das Gehirn selbst physisch verändert und die Grundlage für jegliches Lernen und Verlernen schafft. Das lässt sich gut mit einer Wanderung im Wald veranschaulichen: Zunächst ist es ein sehr kräfteraubender und unkoordinierter Prozess, unbetretene Pfade zu bestreiten. Je öfter diese aber begangen werden, desto klarer wird die Richtung und umso müheloser das Durchlaufen.
Das grundlegende Zusammenspiel einzelner Neuronen als Manifestation von Gehirnaktivität kann mit der Orchester-Analogie besser verständlich gemacht werden: einzelne individuelle Instrumente (Neuronen), die erst in einer komplex koordinierten Komposition des Orchesters (Gehirns) eine wunderschöne Symphonie spielen. Wenn man nun also effektiv an die Funktionsweise des Gehirns angepasst lernen will, muss man also neuronale Bahnen stärken. Aber wie?
Frequenz und Intensität des Lernens
Die logischerweise zuerst abgeleitete Stellschraube ist also die Häufigkeit, mit der bestimmte Neuronen bei einer Aktivität miteinander kommunizieren. Dabei ist es aktueller wissenschaftlicher Konsens, kürzere Lernintervalle mit entsprechenden Pausen zu bevorzugen, anstatt mehrere Stunden auf einmal in die Tätigkeit zu investieren. Ganz konkret werden intensive Lernperioden zwischen 30 Minuten und einer Stunde und empfohlen, gefolgt von Pausenzeiten zwischen 15 Minuten und 30 Minuten. Das liegt daran, dass das Gehirn die tatsächliche Verstärkung der neuronalen Bahnen in den Erholungsphasen bildet, weswegen auch guter Schlaf als Regeneration fundamental wichtig für den Lernerfolg ist.
Unabhängig von der Lernhäufigkeit wurde festgestellt, dass die Intensität, mit der die Neuronen "feuern", noch maßgeblich von einem weiteren Parameter abhängig ist: der Anstrengung. Liest man beispielsweise nur passiv die zu lernenden Informationen, so ist die Aktivität im Gehirn deutlich geringer, als wenn man versucht, sich an diese zu erinnern. Deswegen belegen auch zahlreiche Studien, dass regelmäßige Tests bei Schülerinnen und Schülern sich sehr positiv auf den Lernerfolg auswirken, da diese stetig gefordert werden, den Stoff aus ihrem Gedächtnis abzurufen.
Gemäß derselben Logik ist, jemand anderem etwas zu erklären oder beizubringen, ebenso eine effektive Strategie zur tieferen Verinnerlichung der Lerninhalte, da man sich dabei selbst aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen muss. Dementsprechend sind für Vokabellernen Karteikarten besser geeignet, für mathematische Probleme Übungsaufgaben und für koordinative Tätigkeiten die praktische Ausführung.
Freude statt Zwang
Ein weiteres Werkzeug für effektiveres Lernen sind Emotionen. Von klein auf verstärkt unser Gehirn die neuronalen Bahnen von Aktivitäten, die in positiven Emotionen wie Lob, Freude, Spaß oder Befriedigung resultieren. Analog dazu fördert das Gehirn Verbindungen, die negative Emotionen wie Schmerz, Trauer oder Ablehnung vermeiden. Schmerz ist ein hervorragender Lehrer: Wer sich einmal an der Herdplatte verbrannt hat, tut dies in der Regel danach zumindest seltener. Da negative Emotionen jedoch physiologische Veränderungen mit sich ziehen, die kontraproduktiv für eine gesunde Basis des Lernens sind, sollte man mit positiven Emotionen beim Lernen arbeiten.
Studien belegen, dass Schüler und Schülerinnen, die im Klassenzimmer mehr positive Emotionen erleben, eine gesteigerte Lernmotivation, größeren Lernerfolg und optimistischere akademische Ziele zu verzeichnen haben. So sehr Erwachsene manchmal meinen, sie wären mit Kindern nicht mehr vergleichbar, sind diese Erkenntnisse bewiesenermaßen altersunabhängig zutreffend. So sollte man für einen optimalen Lernerfolg seinen Lernprozess zu einer angenehmeren Erfahrung zu machen, bei der positive Emotionen auftreten, die das Gehirn instinktiv gerne wiederholen lässt.
Dies beginnt bereits damit, einen geeigneten Ort auszusuchen, an dem man sich wohlfühlt, wie die Natur oder ein schön eingerichtetes Zimmer. Darüber hinaus kann man während des Lernens seine Lieblingsmusik hören oder von seinen Lieblingssnacks naschen. Eine unmittelbar nach der Lerneinheit antizipierte Belohnung, wie auch immer diese aussieht, kann ebenso hilfreich sein. Im Endeffekt ist alles möglich, was das Gehirn den Lernprozess an sich, unabhängig vom Erfolg, positiv assoziieren lässt.
Selbstbild bestimmt Lernpotenzial
Der jedoch unterschätzteste und möglicherweise ausschlaggebendste Aspekt des erfolgreichen Lernens ist das Selbstbild der eigenen Lernfähigkeit. Eine Metastudie ergab, dass schon das Lehren des Konzepts der Neuroplastizität sowohl die Motivation der Lernenden als auch deren Erfolg und Gehirnaktivität erhöhten. Allein der Glaube an das eigene, tatsächlich wissenschaftlich belegte Potenzial führte bei den Testpersonen im Alter von sieben Jahren bis hin ins Erwachsenenalter zu eindeutigen Verbesserungen.
Hier besteht vermeintlich eines der Hauptprobleme erfolgreichen Lernens: ein Selbstbild, das besagt, man sei "einfach schlecht in Mathe" oder "sprachlich unbegabt", als gehöre dies zur eigenen Persönlichkeit. Ein unglücklicher Mathe-Test und eine pädagogisch suboptimale Lehrperson in der vierten Klasse können Grund genug sein, um ein Kind in seinem Selbstbild langfristig zu beeinflussen und die zukünftigen Ergebnisse zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu machen.
Oft noch gravierender ist etwa die übliche leistungsbezogene Einschätzung nach der vierten Klasse, nach der man in eine entsprechende weiterführende Schule geschickt wird. Ein Kind, das in eine Mittelschule geschickt wird, erwartet mindestens unterbewusst auch eine dementsprechende Leistung von sich. Barbara Oakley, Professorin für Ingenieurwissenschaften, sagt über sich selbst, sie habe in der dritten Klasse den Anschluss in Mathe verloren und sich seit damals nur noch durchgemogelt.
Jeder Mensch birgt unfassbares Lern- und Wachstumspotenzial in sich, der eine schneller, der andere langsamer. Der eine eher mittels Individualunterrichts, der andere autodidaktisch und ein ganz anderer wiederum im Gruppenkurs. Sich seiner eigenen Präferenzen permanent bewusst zu sein, um sich nicht zu fragen "Ob man es kann", sondern nur "Wie" – einer Generation das wirklich beizubringen wird wahrscheinlich das Nützlichste sein, was sie lernen kann. (Tobias Goretzki, 4.8.2022)