Die Beträge sind atemberaubend. Etwas mehr als 46 Milliarden Euro hat sich die Republik Österreich die Corona-Hilfen kosten lassen. Allein die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag), über die nur die direkten Unternehmenshilfen abgewickelt wurden, hat mehr als 18 Milliarden Euro an Zuschüssen ausbezahlt und Garantien vergeben.
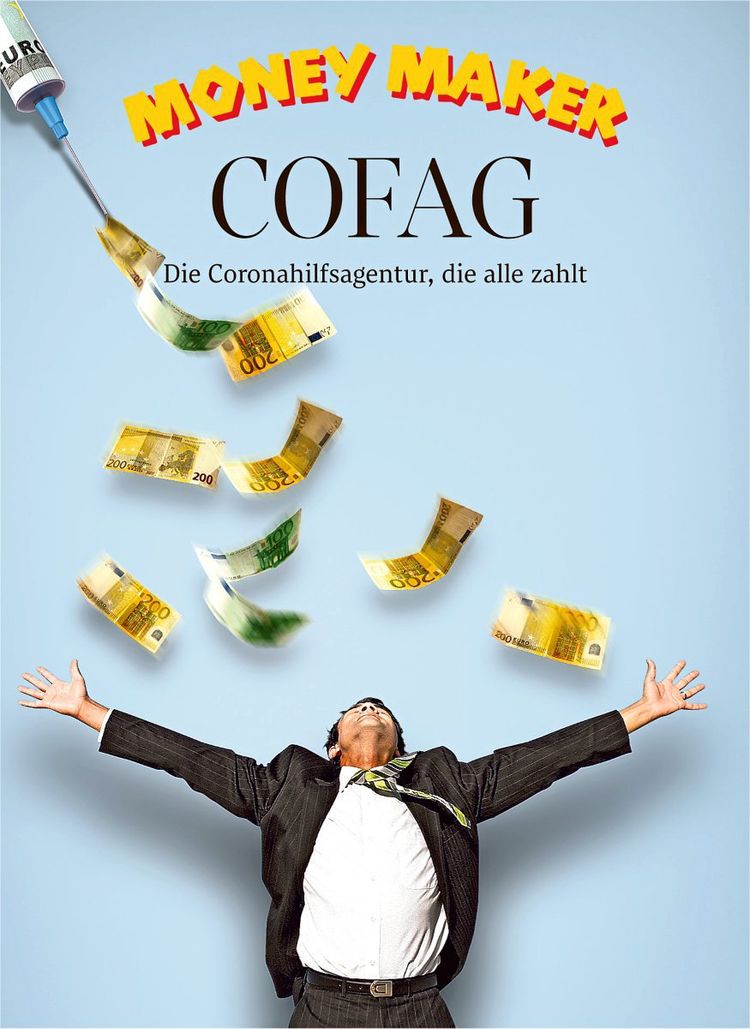
Zur Einordnung: Mit den gesamten Corona-Hilfen für die Wirtschaft ließe sich das Schulsystem Österreichs vier Jahre lang durchfinanzieren, wenn die Ausgaben unverändert blieben. Bei der Polizei wären die Kosten 13 Jahre gedeckt. Bei der Mindestsicherung, die zuletzt eine Milliarde pro Jahr gekostet hat und wo früher gefühlt über jeden ausgegebenen Euro diskutiert wurde, würde das Geld für mehr als 40 Jahre reichen.
Die Zahlen sind bekannt, das Thema Corona-Hilfen ist seit vergangener Woche plötzlich wieder aktuell, nachdem ein Rohbericht des Rechnungshofes über die Cofag an die Öffentlichkeit gekommen ist. Der Rechnungshof zerpflückt die Konstruktion der Finanzierungsagentur: Kritisiert werden Personalbestellungen, überhöhte Gehaltszahlungen für den Ex-Cofag-Chef, hohe Ausgaben für externe Berater.
Mehrfach- und Überförderungen
Zugleich wird die Ausgestaltung der Hilfen bemängelt: Von systematischen Mehrfachförderungen ist die Rede und der Überförderung von Unternehmen. Da wurden Verluste ersetzt, die gar nie angefallen sind. Große Unternehmen wurden bevorzugt, während kleine abgespeist wurden, obwohl Konzerne natürlich mehr Reserven haben, um eine Krise zu überstehen.
Die Opposition übt Kritik und will die Causa parlamentarisch untersuchen lassen. Erste Aufklärung soll im Herbst ein "kleiner U-Ausschuss" liefern. So heißen Unterausschüsse des Rechnungshofausschusses, die mit einem Viertel der Stimmen – also etwa SPÖ und Neos – eingesetzt werden können und sich mit Rechnungshofberichten auseinandersetzen.
Gegenüber richtigen U-Ausschüssen hat dieses Untersuchungsgremium aber Nachteile. Die Befragungen sind nicht medienöffentlich, Ministerinnen und Minister können nicht so gut in die Mangel genommen werden, weil sie Fragen an anwesende Beamte weitergeben können. Dort besteht keine Wahrheitspflicht.

Dabei hätte nicht nur die Opposition Fragen: Selbst innerhalb der Koalition soll man bass erstaunt darüber gewesen sein, welche Summen da bei der Cofag ausgegeben wurden: 21 Millionen Euro für externe Berater, allein 125.000 Euro für Protokollführer.
Erkaufte Zustimmung
Aber lässt sich schon jetzt nachzeichnen, was da schiefgelaufen ist und wo all die Gelder gelandet sind? Ja! Vieles von dem, was der Rechnungshof kritisiert, ist nicht unbeabsichtigt passiert, sondern war genau so gewollt und im Grunde bekannt. "Unser Zugang ist: Koste es, was es wolle", hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) früh in der Pandemie als Devise bei den Wirtschaftshilfen vorgegeben. Und genau an diese Vorgabe haben sich die Architekten der Corona-Hilfen im Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP) im Wesentlichen gehalten.
Es war ein dezidiertes Ziel, Unternehmen ihre Verluste möglichst umfassend zu ersetzen oder sie sogar systematisch zu überfördern. Denn damit, so der Plan der Regierung, könne man den Kritikern an den harten Lockdowns am besten den Wind aus den Segeln nehmen.
Aus der Tourismusindustrie kam schon früh der Hinweis, dass andere Länder nicht alles zusperren und in einen Lockdown gehen wie Österreich. Bestes Beispiel dafür war das Wintertourismusland Schweiz, wo im Herbst 2020 Gastro und Hotellerie nicht runtergefahren wurden. Österreich hat sich zur selben Zeit für den Lockdown entschieden, diesen aber den geschlossenen Betrieben vergoldet. Zugleich hat die ÖVP mit den üppigen Zahlungen die Interessen ihrer Wähler und ihrer Klientel vertreten: der Unternehmerinnen und Unternehmer.
"Bazooka-Gießkanne"

Gestottert hat der Hilfsmotor nur zu Beginn der Pandemie. Beantragung und Abwicklung der Zahlungen dauerte aus Sicht vieler Betroffener zu lange und war kompliziert. Das große Geldausgeben begann im Herbst 2020, am 17. November, als der zweite Lockdown verkündet wurde: Damals wurde die bisherige Strategie über den Haufen geworfen und die Hilfen nach der lauten, auch medialen Kritik an den schleppenden Auszahlungen umgestellt. Künftig sollte es schnell gehen und viel geben. Das war die Devise.
Die größten Überförderungen gab es beim Umsatzersatz – der "Bazooka-Gießkanne", wie der Ökonom Paul Pichler das Hilfsinstrument nennt. Es stand Betrieben während des Lockdowns im November und Dezember 2020 zu. Ob der Umsatz eines Unternehmens tatsächlich zurückgegangen war oder nicht, spielte bei der Bemessung der Hilfen damals keine Rolle. Relevant war ausschließlich, ob eine Schließung der Kundenbereiche angeordnet war.

Viele Unternehmen arbeiteten aber weiter: So konnten zum Beispiel Autohändler staatliche Unterstützung beziehen. Nun waren in ihren Schauräumen zwar keine Kunden erlaubt. Die Autohändler konnten aber wohl Fahrzeuge ausliefern und Bestellungen entgegennehmen. Viele Händler finden sich unter den großen Hilfsempfängern.
Schlangen am Drive-in
Auch das Takeaway-Geschäft in Restaurants wurde bei den Hilfen nicht in Abzug gebracht. McDonald’s und Burger King konnten Millionengelder kassieren, obwohl sich vor deren Drive-in-Schaltern lange Autowarteschlangen bildeten. Und es wurde ordentlich gezahlt: Bei direkt von Schließung betroffenen Unternehmen wie Restaurants und Hotels gab es zunächst 80, dann 50 Prozent vom Vorjahresumsatz als Ersatz. Im Handel gab es niedrigere, gestaffelte Ersatzraten.
Dadurch, dass Verluste gar nicht Voraussetzung waren, um Hilfen zu erhalten, bekamen auch Unternehmen Geld, die trotz Lockdowns ein gutes Wirtschaftsjahr hatten: Der Media-Markt-Mutterkonzern Ceconomy konnte dank Onlinebestellungen und eines Booms bei langlebigen Konsumgütern wie Kühlschränken seinen Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2020/2021 sogar steigern.
Dennoch bekam Media-Markt Geld. Auch der Lebensmittelhändler Spar hatte ein gutes Jahr und wurde trotzdem gefördert mit 800.000 Euro: als Ersatz für Schließung der 53 Interspar-Restaurants.
Damit kein Missverständnis entsteht: Ein Unternehmer, der ihm zustehende Förderungen nicht abholt, ist ein schlechter Kaufmann. Viele Firmen haben trotz hoher Förderungen Verluste gemacht, manche mussten lange auf Geld warten. Aber die Hilfen waren so konzipiert, dass oft nicht nur Verluste komplett ersetzt wurden, sondern es lukrativ sein konnte, im Lockdown zu sein. Und die Interessensvertretungen der Betriebe waren natürlich im Hintergrund an der Ausgestaltung der Unterstützung beteiligt.
Es war nicht nur das Tempo
Im System gab es noch andere Blüten. Der zweite große Hilfstopf bestand aus dem staatlichen Kurzarbeitsgeld. Betriebe waren nicht verpflichtet, Hilfen gegeneinander aufzurechnen. Sie konnten doppelt zugreifen.
Ein Unternehmen konnte also beispielsweise Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, hatte somit keine oder geringere Kosten für Arbeitskräfte. Dennoch gab es Geld von der Cofag, obwohl mangels Umsätzen beim Unternehmen auch für Waren keine Kosten anfielen. Das war bei späteren Hilfsinstrumenten ebenso der Fall, die es auch abseits der Lockdowns gab, was die Tendenz zur Überförderung verstärkte.
Kurios waren auch die Mietbeihilfen: Unternehmen konnten sich Mietausgaben von der Cofag ersetzen lassen. Dabei galt, dass auch verbundene Unternehmen, bei denen eine Gesellschaft einer Schwestergesellschaft ein Gebäude vermietet, Zuschüsse für die Miete erhielten. Dabei bestand hier nur ein konzerninternes Geschäft. Besonders bei Hotels und Möbelhäusern sind solche Konstruktionen beliebt.
Kaum Kontrollen
Kontrollen bei Auszahlungen gab es im Übrigen, wie der Rechnungshof festhält, bis auf automatisierte Prüfungen, ob die Angaben der Unternehmen plausibel sind, kaum.
Wer Ökonomen danach fragt, wie es zu alldem kommen konnte, bekommt oft zu hören, dass es bei Hilfen schnell gehen musste. Aber das erklärt nur einen Teil der Vorgänge. In Deutschland, wo die gleiche Krise herrschte, musste Kurzarbeit mit anderen Hilfen sehr wohl gegengerechnet werden. Es wäre also auch anders gegangen.
Wo sind also die ganzen Corona-Milliarden gelandet? Der größte Teil als Zuschüsse und Garantien bei Unternehmen. Dazu kommen gewährte Steuerstundungen an Firmen vom Finanzministerium, die allerdings zurückzuzahlen sind. Ein großer Brocken bei den Hilfen war die erwähnte Kurzarbeit. Daneben gab es andere Unterstützung, etwa für Vereine.

Effekte bis heute nicht evaluiert
Was waren die genauen Effekte des großen Geldausgebens? Das ist vielleicht der kurioseste Aspekt der Geschichte: Bis heute kann das niemand sagen. "Es hat keine umfassende Evaluierung gegeben", sagt Wifo-Ökonom Oliver Fritz. Kein Ministerium hat bisher bei Wirtschaftsforschern eine Analyse beauftragt. Es war also nicht einmal gelogen, als Finanzminister Blümel im Februar 2021, als er nach der Wirkung der Hilfen gefragt wurde, zu Journalisten meinte: "Da würden mich konkrete Daten sehr interessieren, wenn Sie die haben."
Fakt ist, dass eine Welle an Firmenpleiten verhindert wurde. Trotz Pandemie waren Unternehmenspleiten rückläufig. Aber auch das ist ein zweischneidiges Schwert: Zu einer gesunden Marktwirtschaft gehört dazu, dass unproduktive Unternehmen ausscheiden, um nicht Kapital und Arbeitskräfte zu binden. Es ist auch nicht gesagt, dass es effektiv ist, Pleiten zu verhindern. "Die Unterstützung war zu breit. Letztlich wurde damit der notwendige Strukturwandel bloß nach hinten verschoben", sagt Ricardo-José Vybiral, Chef des Kreditschutzverbandes von 1870.
Die Corona-Hilfen sind also üppig geflossen, es wurde wenig kontrolliert, es gab eine gezielte Strategie zu überfördern, die Wirkung der Pakete ist zweifelhaft, wurde aber nie umfassend analysiert. Wenn das alles offensichtlich war, warum war die Kritik nicht lauter, schon vor dem Rechnungshofrohbericht?
Sie waren alle zufrieden
Eine Antwort darauf lautet, dass vom System so gut wie alle profitierten. Die Wirtschaftsverbände hatten keinen Grund, über zu viel Geld zu klagen. Gewerkschaften und Arbeiterkammer auch nicht, sie waren mit der generös ausgestalteten Kurzarbeit sehr zufrieden – die übrigens in der Anfangsphase selbst auch ein Instrument der Unternehmensförderung war.

Auch von den Ökonomen kam mit Ausnahmen, wie den hier zitierten Experten, kaum Kritik. Dabei lieben es Wirtschaftswissenschafter ansonsten, über Anreize zu diskutieren. Und genau hier schien sich der alte Spruch zu bewahrheiten: Wenn der Staat will, dass Unternehmen etwas tun, gibt er Förderungen. Bei Armen übt er Druck aus.
Der kleine Untersuchungsausschuss im Herbst wird diese Themen bearbeiten, aber sich auch um die Struktur und personelle Besetzung der Cofag kümmern. Im Zentrum der Kritik steht hier Ex-Cofag-Chef Bernhard Perner, der zunächst gleichzeitig Chef der staatlichen Bankenabbaugesellschaft Abbag und Manager bei der Staatsholding Öbag war, ehe er den Job bei der Öbag gewissermaßen für den Chefposten bei der Cofag eintauschte.
Rund 117.000 Euro erhielt Perner für seine Arbeit zwischen März und Dezember 2020, obwohl die Cofag eine Tochterfirma der Abbag war und es laut einer Konzernklausel "kein Entgelt für Tätigkeit in der Tochtergesellschaft" geben hätte sollen. Perner verteidigte das, "jeder" habe seine Verträge gekannt, und er habe viel gearbeitet.
Doch abseits der pflichtbewussten öffentlichen Minimalverteidigung springt selbst die ÖVP Perner nicht bei. Ein Beamter, der mit seiner Arbeit auch rund um Corona-Hilfen mehr als der Kanzler verdiente? Das kommt nicht gut an. Tatsächlich ist schon die Rede von Parallelen zur Affäre rund um Thomas Schmid, dessen Namen die ÖVP mittlerweile scheut wie der Teufel das Weihwasser.
Der enge Vertraute
Schmid und Perner hatten jahrelang eng zusammengearbeitet. Perner war Teil jener politischen Kreise im Finanzministerium, die mehr und mehr Macht an sich gebunden haben. Die Grenzen zwischen Beamtenschaft und Politik verschwanden, Perner spielte da eine wichtige Rolle.
Der gelernte Chemiker kam nach einer Zwischenstation beim Berater Deloitte ins Kabinett von Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP), bei ihrem Nachfolger Michael Spindelegger lernte er dann Thomas Schmid kennen – und zwar als seinen vorgesetzten Kabinettschef.
Als Schmid sich die Staatsholding Öbag zimmerte, war Perner hautnah dabei – und fing dann eben auch Teilzeit bei der Staatsholding an. Den Absturz von Schmid überlebte Perner nahezu unbeschadet, einzig von der von ihm mitgestalteten türkis-blauen Bankenaufsichtsreform musste er sich verabschieden.
In der Herangehensweise stehen aber sowohl Schmid als auch Perner für einen größeren Trend in der österreichischen Verwaltung. Große Projekte werden kaum mehr ministeriumsintern durchgeführt, sondern ausgelagert und dabei massenhaft Aufträge an gut bekannte Berater und Consulter verteilt – bei denen man dann im Zweifel nach dem Abschied aus dem Öffentlichen Dienst selbst landen kann.
Warum die Regierung so etwas fördert? Im Zweifel kann man sich an der ausgelagerten Gesellschaft abputzen, Erfolge aber für sich reklamieren. Und es ist für die Opposition schwieriger, Geldflüsse zu kontrollieren, weil oft das parlamentarische Interpellationsrecht nicht greift. (András Szigetvari, Andreas Danzer, Fabian Schmid, 20.8.2022)