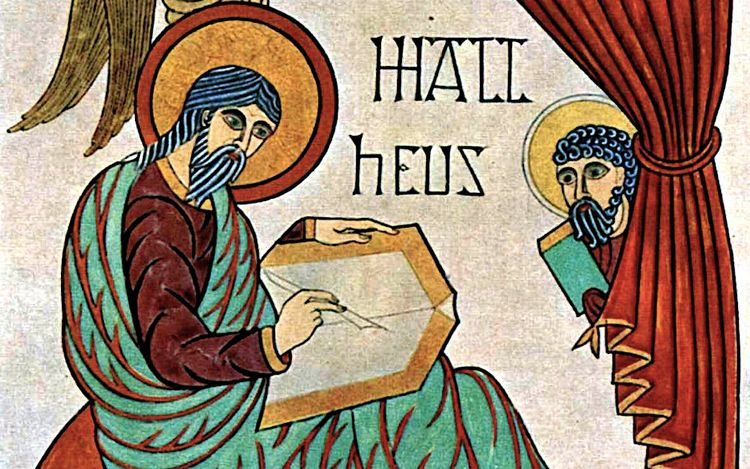
Der heilige Matthäus beim Schreiben. Eine neue Studie bestätigte ein weiteres Mal den nach ihm benannten Effekt.
"Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat." So steht es im Matthäusevangelium geschrieben. Und auch wenn die Weisheiten des Neuen Testaments nicht immer mit der Wissenschaft kompatibel sind: In diesem Fall erwiesen sie sich sogar als prophetisch und bringen eine wichtige wissenschaftssoziologische Erkenntnis auf den Punkt, die weit über die Wissenschaft hinausreicht: Aktuelle Erfolge haben nicht notwendigerweise etwas mit besonderen gegenwärtige Leistungen zu tun, sondern erklärten sich oft genug ausschließlich aus früheren Erfolgen oder einem "prominenten" Namen.
Das mag man in Kunst und Kultur als triviale Einsicht hinnehmen. In der Wissenschaft sorgte dieser vom großen US-Soziologen Robert K. Merton 1968 erstmals beschriebene Matthäus-Effekt für einiges Aufsehen, hat es doch ihr Selbstbild erschüttert, rein meritokratisch zu verfahren und den besten Leistungen auch am meisten Wertschätzung zukommen zu lassen – egal ob nun bei Begutachtungsverfahren, bei Berufungen, bei Zitierungen oder bei wissenschaftlichen Auszeichnungen bis hin zum Nobelpreis.
Diese nichtmeritokratischen Beurteilungsmuster gelten aber nicht nur auf individueller Ebene, sondern etwa auch nach Herkunft oder Geschlecht: Letzte Woche erst zeigte eine Studie, dass Artikel von Frauen etwas weniger oft zitiert werden als die von Männern. Und der südafrikanische Bioinformatiker Tulio de Oliveira, dem wir die Entdeckung und rasche Bekanntmachung der Omikron-Variante verdanken, meinte erst kürzlich in einem vernichtenden Leitartikel für das renommierte Medizin-Fachblatt "The Lancet": "Forscher in Afrika müssen mindestens doppelt so viel produzieren, um weniger als die Hälfte der Anerkennung von Forschern aus Ländern mit hohem Einkommen zu erhalten."
Studie mit "Wirtschaftsnobelpreisträger"
Eine weitere empirische Bestätigung kommt nun aus dem Bereich Peer-Review durch eine Studie unter der Leitung von Jürgen Huber (Institut für Banken und Finanzen der Universität Innsbruck). Um die Ungleichbehandlung im Begutachtungsprozess von Artikeln in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu belegen, führte das sechsköpfige Forschungsteam der Universitäten Innsbruck und Graz sowie der Chapman University in den USA ein einfaches Experiment durch, das nur gelingen konnte, weil Vernon Smith, "Wirtschaftsnobelpreisträger" des Jahres 2002 und Professor der Chapman University in den USA, dabei mitmachte.
Er verfasste nämlich gemeinsam mit dem Nachwuchswissenschafter Sabiou Inoua, der ebenfalls an der Chapman University forscht, einen wissenschaftlichen Artikel. Diesen reichten die beiden Autoren beim "Journal of Behavioral and Experimental Finance" zur Begutachtung ein. Stefan Palan, Professor an der Universität Graz, Herausgeber der Fachzeitschrift und Mitglied des Forschungsteams, verteilte das Manuskript ausnahmsweise nicht an drei, sondern an insgesamt 3.300 Fachgutachterinnen und Fachgutachter.
534 von ihnen nahmen die Einladung an und erhielten genau denselben Artikel. Sie erhielten aber unterschiedliche Informationen darüber, wer den Artikel verfasst hatte. Eine Gruppe erfuhr, dass einer der Autoren Nobelpreisträger Vernon Smith war, eine andere Gruppe erfuhr, dass einer der Autoren Nachwuchswissenschafter Sabiou Inoua war, und eine dritte Gruppe erhielt keine Informationen zu den Autoren.
Reputation des Autors entscheidet
Die Ergebnisse wurden vergangene Woche in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht. Von den Gutachterinnen und Gutachtern, die keine Informationen über den Autor des Fachartikels erhielten, haben knapp 50 Prozent empfohlen, diesen nicht zu publizieren. Wussten sie nur, dass einer der Autoren der unbekannte Nachwuchswissenschafter ist, so stiegt dieser Anteil sogar auf über 65 Prozent. Wussten die Gutachter hingegen, dass einer der Autoren der Nobelpreisträger ist, so empfahlen nur rund 23 Prozent eine sofortige Ablehnung.
"Unsere Ergebnisse zeigen damit deutlich, dass die unterschiedlichen Informationen über den Verfasser die Bewertung der Qualität des Forschungsartikels stark beeinflussen", resümiert Jürgen Huber, Professor am Institut für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck. Die Ergebnisse sieht das Forschungsteam als wichtigen Anstoß dafür, das Begutachtungsverfahren wissenschaftlicher Arbeiten zu überdenken. Gerade in der akademischen Welt seien die Ergebnisse der neuen Studie deshalb auf großes Interesse gestoßen. (red, tasch, 10.10.2022)