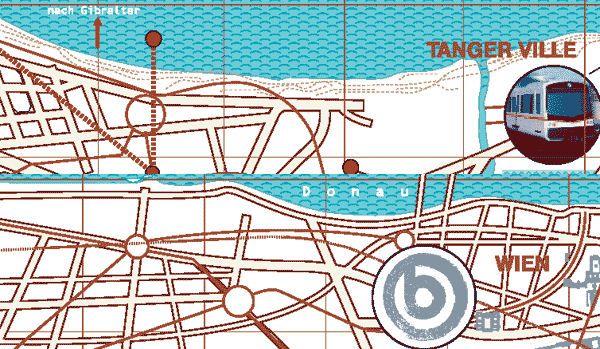Auszüge aus der Rede die der Schriftsteller Navid Kermani im Herbst 2005, anlässlich der Feiern zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Burgtheaters, in Wien gehalten hat.
***
Auf meinem Laptop habe ich einen Routenplaner. Um zu ermessen, was in den letzten fünfzig Jahren mit Europa geschehen ist, brauche ich nicht mehr als Nordkap einzutippen und danach Tarifa, die südlichste Stadt Spaniens. Nach fünfzehn oder zwanzig Sekunden verkündet der Laptop fähnchenwedelnd das Ergebnis: Am Nordkap fahre ich 700 Meter auf einer örtlichen Straße, halte mich zweimal links und gelange nach 280 Metern auf die E 69. Nach weiteren 5930,20 Kilometern biege ich von der spanischen N 5 links ab auf die CN 340, die nach 400 Metern übergeht in die Avenida Mirador de los Ríos. Nach 600 Metern fahre ich in Tarifa ein. Mein Laptop veranschlagt eine Reisedauer von sieben Tagen, drei Stunden und 57 Minuten. Eine Grenzkontrolle vermerkt mein Laptop nicht. Ich gehe die Route genau durch: fünf Grenzübertritte, aber keine einzige Wartezeit für eine Grenzkontrolle. An Stockholm käme ich vorbei, an Kopenhagen, an Hamburg, Brüssel, Paris, Madrid – und kein Pass.
Als dieses Theater heute vor fünfzig Jahren wiedereröffnet wurde, hätte wohl kaum einer der Anwesenden für möglich gehalten, was uns allen heute selbstverständlich geworden ist: ein Europa ohne Grenzen.
Heinrich Mann hat einmal behauptet, dass das Gemeinschaftsgefühl der Europäer eine Erfindung der Dichter sei. Damit mag er übertrieben haben, und dennoch ist auffällig, wie entschieden sich während der vergangenen zweihundert Jahre gerade die Literaten für Europa ausgesprochen haben. Den Politikern waren sie Jahrzehnte voraus, wenn nicht ein ganzes Jahrhundert. Als Victor Hugo 1851 vor der französischen Nationalversammlung für eine Union der demokratisch verfassten europäischen Länder warb, ging seine Rede im Protest und Hohngelächter seiner Kollegen unter.
Auch als heute vor fünfzig Jahren das Burgtheater wiedereröffnet wurde, hatte Europa noch längst nicht die europäischen Nationalismen entschärft, wie die Aufregung um das Eröffnungsprogramm andeutet: Der öffentliche Druck zwang die damalige Direktion des Burgtheaters, das österreichische Nationaltheater mit einem österreichischen Stück zu eröffnen. Nicht im Parkett saßen damals einige der bedeutendsten Europäer, die Österreich hervorgebracht hat. Sie hatten nicht überlebt.
Noch 1932 schrieb Stefan Zweig, dass Europa "endlich wieder einen der Höhepunkte europäischer Humanität" erreicht habe. Zweig übersah die Stärke der nationalistischen Gegenkräfte keineswegs, "die Macht der kleinen, kurzdenkenden Interessen, die den großen notwendigen Ideen entgegenwirken, die Gewalt des Egoismus gegen den verbrüdernden Geist", wie er es nannte. Niemals sei "die Absonderung von Staat zu Staat in Europa größer, vehementer, bewusster, organisierter als heute." Und dennoch spürte Zweig, dass Europa nach einer langen Epoche der Brutalität und Entfremdung zum ersten Mal wieder fühlte, "an einem Gemeinsamen" zu arbeiten. Zweigs Glaube an Europa erwuchs nicht aus der Analyse der politischen Gegenwart, sondern aus der Verzweiflung über sie. Sein Plädoyer für Europa war 1932 nicht realistisch, sondern messianisch. Zweig glaubte, wie er selbst schrieb, "an Europa wie an ein Evangelium".
1934 musste Stefan Zweig aus Österreich fliehen. Am 23. Februar 1942 brachte er sich im brasilianischen Petrópolis um. Heute ist Europa eine Realität. So utopisch Zweig sich selbst vorkam, hat er doch Recht behalten, hat er gesiegt über jene, die ihn in den Tod zwangen, und auch jene überlebt, die vor fünfzig Jahren in dieses Theater kamen, um die Wiedergeburt Österreichs zu feiern statt des Endes des nationalistischen Wahns. Stefan Zweig hat gesiegt und mit ihm Heine, Nietzsche, Benjamin, die Gebrüder Mann, Hesse, Hofmannsthal, Tucholsky, Döblin, um nur einige der deutschsprachigen Schriftsteller anzuführen, die für ihren Einsatz für Europa von ihrer eigenen Zeit bestenfalls verlacht, fast immer vertrieben und schlimmstenfalls umgebracht worden sind. Wie für so viele jüdische Intellektuelle seiner Zeit war Europa für Zweig mehr als nur ein Projekt oder eine großartige Idee. Es war eine Lebensnotwendigkeit. Als Jude fand er keinen Platz in den europäischen Nationalismen. Aufgehen konnte er nur in einer transnationalen Humanität, die durch Werte geeint ist, durch einen Prozess der Säkularisation, nicht durch eine Ethnie, Sprache oder Religion. Auch heute findet man die enthusiastischen Europäer dort, wo Europa nicht selbstverständlich ist, in Osteuropa, auf dem Balkan oder in der Türkei, unter Juden und Muslimen. Wer wissen will, wie viel dieses überbürokratisierte, apathische, satte, unbewegliche, entscheidungsschwache Gebilde namens Europäische Union wert ist, muss dorthin fahren, wo es aufhört.
Ich habe das getan, um diese Rede über Europa zu schreiben. Vor drei Wochen, also bevor sich die Ereignisse dort überschlagen haben, bin ich zu denen gegangen, die alles aufgeben haben, nur um nach Europa zu gelangen: zu den Flüchtlingen an den Toren der Europäischen Union. Heute Morgen bin ich aus Marokko zurückgekommen. Ich möchte Ihnen von dieser Reise erzählen und auch von den Büchern, die ich im Gepäck hatte. Neben Stefan Zweig war ein weiterer Autor aus Österreich dabei, der die Wiedereröffnung des Burgtheaters nicht mehr erlebte: Josef Roth. Es gibt ein frühes Buch von Roth, das, bis heute gültig, Europa zwischen den beiden Weltkriegen beschreibt, eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, sodass ihre Bewohner sich unversehens an immer neuen Orten finden, immer wieder neu flüchten, sich in immer neuen Konstellationen wiederfinden. Ich meine seinen Roman "Hotel Savoy" aus dem Jahr 1929. Die prunkvolle Fassade des Hotels, das dem Roman seinen Namen gegeben hat, zeugt noch von der Vorkriegsepoche. Im Inneren beherbergt es eine bunte Schar aufgelöster Existenzen, die sich im Provisorischen eingerichtet haben: Millionäre, Bankrotteure, Devisenschieber und Tänzerinnen.
Das Hotel Savoy gehört keiner fernen Epoche an. Es liegt heute in Tanger, 30 Kilometer südlich von Tarifa. Es heißt nicht Hotel Savoy, sondern Pension de la Paix, Pension Andalus, Pension Fuentes, Pension Sevilla, Pension Hoffnung. Vor dem Hotel Sevilla kam ich mit sechs Gästen ins Gespräch, kaum zwanzig Jahre alt der jüngste, vielleicht vierzig der älteste. Was sie in Europa wollen, fragte ich in die Runde. Arbeit, natürlich, ein normales Leben, mehr nicht. Dass man ein bisschen Sicherheit hat, nicht jeden Tag von Neuem kämpfen muss ums Überleben, eine Chance bekommt, eine Familie zu gründen oder die Freundin wenigstens einmal ausführen kann. Auto und Urlaub gehören nicht zu dem normalen Leben, von dem sie träumen; wichtiger ist ihnen, dass das Geld reichen wird, um der Familie von Zeit zu Zeit etwas zu überweisen. Einer kramt einen Zettel aus der hinteren Hosentasche: eine französische Arbeitsbescheinigung. 700 Euro hat er dafür bezahlt, aber als er mit dem Zettel beim französischen Konsulat vorsprach, hätten die Beamten die Fälschung gleich bemerkt. Jetzt kratzt er das Geld für eine Fahrt mit dem Schlauchboot zusammen. Keine faulen Kompromisse mehr, sagt er. Ob einer von ihnen bereits versucht habe, mit dem Boot nach Europa zu kommen, frage ich. Zweimal war ich schon drüben, sagt der erste und schaut in die Runde. Dreimal, sagt der nächste, einmal, viermal, und so weiter. Irgendwo setzen sie nachts über, werden von der spanischen Polizei auf hoher See oder am Strand geschnappt und nach Marokko zurückgebracht.
Viele unter Ihnen werden sich an die Bilder der maroden Flüchtlingsfrachter erinnern, an die 911 Passagiere, die am 17. Februar 2001 am südfranzösischen Strand Boulouris gelandet sind, oder an das Totenschiff, das im Oktober 2003 von den italienischen Behörden an die Küste Lampedusas gezogen wurde: Alle Passagiere waren verdurstet. Wir haben vielleicht das Werbeplakat von Benetton vor Augen, das heillos überfüllte Schiff vor Bari, von dem junge Albaner ins Meer springen, um sich ans Ufer zu retten.
Kaum bekannt ist, dass inzwischen über achtzig Prozent der Flüchtlinge mit kleinen Schlauchbooten nach Europa übersetzen. Wenn ihre Leichen an die europäischen Küsten gespült werden, ist das höchstens eine Meldung für die Lokalpresse des Küstenorts. Geht man davon aus, dass nur jede dritte Leiche gefunden und registriert wird, sind allein im Umkreis der Meerenge von Gibraltar in den letzten fünfzehn Jahren dreizehn- bis fünfzehntausend Flüchtlinge gestorben. Die Meerenge ist damit das größte Massengrab Europas.
Die Marokkaner kennen die Gefahren der Überfahrt genau, schließlich haben sie bereits auf den Booten gesessen. Und wenn sie umkommen? "Dann ist es eben so", sagt einer. "Wir kalkulieren den Tod mit ein, aber der ist auch nicht schlimmer als das Leben hier."
Die übrigen Männer nicken. Wir schweigen eine Weile. Aus dem offenen Fenster der Rezeption höre ich, dass ein Tor gefallen ist, Champions League, Real Madrid gegen Olympiakos Piräus. Alle Männer schauen durchs Fenster oder die Tür, um die Zeitlupe zu sehen. Als sie sich wieder zu mir umdrehen, sagt einer der Männer grinsend: "Das sind eben amaliyyât istischhâdiya, was wir tun, Selbstmordattentate. Die Europäer denken doch, dass alle Araber Selbstmordattentäter sind. Ja, sie haben recht, wir sind alle hier Selbstmordattentäter. Das Paradies, für das wir unser Leben lassen, heißt Schengen."
An klaren Tagen konnte ich von meinem Hotel aus Europa erkennen. Ich verstand es nicht. Wie viele seiner klügsten Geister hat Europa verloren, weil sie vor verschlossenen Grenzen standen, weil sie keine gültigen Ausweispapiere vorzuweisen hatten, keine Visa, keine Devisen. Wie viele Europäer haben nur deshalb überlebt, weil sie vor sechzig Jahren von Tarifa nach Tanger übersetzen durften. Jeden Tag spielen sich an Europas Grenzen und den gegenüberliegenden Küsten die gleichen dramatischen Szenen ab wie vor sechzig Jahren: klapprige Boote, die an einer abgelegenen Stelle ins Meer stechen, beladen mit jungen Männern, Familien, schwangeren Frauen, Kindern. Boote, die kentern, Flüchtlinge, die auf hoher See treiben, bis sie verdursten oder erfrieren. Jeden Tag bringen sich an den Toren Europas Menschen um, weil ihre Fluchthelfer sie im Stich gelassen haben, weil sie ohne Ausweispapiere aufgegriffen werden oder ihre gefälschten Visa entdeckt. Wir kennen all das. Die europäische Literatur hat solche Szenen vielfach beschrieben. Fast alle Motive in Josef Roths "Hotel Savoy" finden sich heute in den Pensionen von Tanger wieder, die Suche nach Gelegenheitsjobs, das Warten auf einen Transfer, die Hoffnung auf Ausweispapiere, die Scham zu verelenden, das Verpfänden noch der letzten Habseligkeiten, die Versuchung, seine Seele oder seinen Körper zu verkaufen, der Tod im Hotelbett, weil die Medikamente unbezahlbar waren.
Durch die Literatur, die Kunst, den Film haben wir teilgenommen an unzähligen europäischen Flüchtlingsschicksalen. Weshalb rufen wir dann reflexartig Schimpfwörter aus, wenn sie uns heute aus der anderen Perspektive begegnen: Illegale, Kriminelle, Menschenhändler, Wirtschaftsasyl, Drogenströme, Terrorismus, das Boot ist voll?
Ich weiß schon, man wird sagen, man dürfe nicht vergleichen. Ich vergleiche nicht die Ursachen. Ich vergleiche die Folgen. Ein Flüchtling, der ertrinkt, ist ein Flüchtling, der ertrinkt. Er muss nicht wegen seiner Rasse oder seiner politischen Gesinnung wegen verfolgt worden sein, um Gründe genug gehabt zu haben, sein Leben zu riskieren, nur um nach Europa zu entkommen. Wer hungrig ist und ein Stück Brot will, ist kein Schmarotzer und schon gar nicht kriminell. Er klagt sein Menschenrecht auf Leben ein. Er gibt dem einfachsten, unmittelbarsten Impuls eines jeden Menschen nach. Wir verhindern jeden Tag, dass Menschen überleben. Wir geben dem einfachsten, menschlichen Impuls nicht nach, dem die Hand zu reichen, der um sein Leben ringt, sondern meinen statt dessen uns selbst schützen zu müssen, schützen vor denen, die bei uns Schutz suchen. Die Grenzanlagen um Ceuta an der marokkanischen Küste erinnern jetzt schon an die frühere innerdeutsche Grenze: Zwei Stacheldrahtzäune, drei und sechs Meter hoch, dazwischen eine Straße, auf der die Jeeps der Guardia Civil ständig patrouillieren, Wachtürme natürlich, Videokameras, Nachtsichtgeräte.
Die Schwarzen wissen genau, dass sie nicht unbemerkt über die Grenzen kommen. Sie versuchen, die Grenzzäune mit soviel Menschen gleichzeitig zu stürmen, dass sie jede Grenzpolizei überfordern. Wenn 500 Leute mit selbst gebauten Leitern auf den Grenzzaun losstürmen, kommen 50 durch – das ist das Kalkül. Ein paar sterben jedes Mal, bei jedem dieser Überfälle, die übrigen werden in die Wüste zwischen Marokko und Algerien deportiert, um noch auf dem Absatz umzukehren und wieder an die Tore Europas zu klopfen, oder besser gesagt: zu versuchen, die Tore einzurennen. Wer das Blut an den Stacheldrahtzäunen gesehen hat, wird nie mehr das Wort "Wirtschaftsasyl" aussprechen wollen ...
Europa ist ein wunderbares Land für Europäer. So schwer seine sozialen und politischen Probleme wiegen – niemals in der Geschichte dieses Kontinents ging es friedlicher und toleranter zu. Das ist viel, und wir vergessen das zu oft. Aber es genügt nicht. Erst wenn Europa menschlich ist zu denen, die nicht zu Europa gehören, ist es "das übernationale Reich des Humanismus", an das Stefan Zweig glaubte wie an ein Evangelium.
Ich muss Ihnen noch verraten, was mein Routenplaner sagt, wenn ich Tarifa und Tanger eingebe. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Strecke überhaupt akzeptiert. Das Gegenteil war der Fall. Das Ergebnis lag nach zwei Sekunden vor. Ich zitiere meinen Laptop wörtlich: Abfahrt Tarifa auf der Avenida de las Fuerzas Armadas. Nach 0,7 Km: Rechts abbiegen (Süd) auf Calle Alcalde Juan. Nach 1,0 Km: Rechts halten (Südwest) auf örtlicher Straße. Nach 31,3 km: Ankunft in Tanger. Der Routenplaner stellt es also als die einfachste Sache der Welt dar, von Europa nach Afrika zu gelangen.
Weder durch Schengen noch durch das Meer lässt er sich beirren: In Tarifa rechts halten auf örtlicher Straße, geradeaus, nach 31,3 km Ankunft in Tanger. Vielleicht sollten wir dem Routenplaner folgen. (DER STANDARD, Printausgabe, 15./16.10.2005)