Wie viel Ungleichheit verträgt eine Gesellschaft, ja die Welt überhaupt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Ökonom und Buchautor Branko Milanović schon seit Jahrzehnten. Weltberühmt wurde er mit seinen Arbeiten, die gezeigt haben, dass die Mittelschicht in westlichen Industrieländern in einer Krise steckt, während die Menschen in aufstrebenden Ländern wie China und Indien in puncto Wohlstand aufholen.
STANDARD: Die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn will einen Teil ihres Vermögens, 25 Millionen Euro, spenden. Ein Bürgerrat soll entscheiden, wer das Geld bekommt. Was hält ein Ungleichheitsforscher von so einer Idee?
Milanović:Das ist eine schöne Geste, für die ich Bewunderung empfinde. Wir dürfen allerdings nicht den Fehler machen, zu glauben, dass so eine Geste ein Ersatz für staatliche Leistungen und Sozialtransfers werden kann. Schon quantitativ geht sich das nicht aus. Es gibt aber auch einen Unterschied, den schon der Philosoph Immanuel Kant angesprochen hat. Bei einer staatlichen Leistung gehen wir im Regelfall davon aus, dass sie uns als Bürgerinnen und Bürger zusteht, dass wir ein Recht darauf haben. Wenn wir ein Geldgeschenk erhalten, ist das anders, dann entsteht sofort eine Beziehung von Ungleichen.
STANDARD: Engelhorn will mit der Aktion auf fehlende Vermögens- und Erbschaftssteuern in Österreich aufmerksam machen. Die Europäische Zentralbank hat gerade ausgerechnet, dass fünf Prozent der Menschen in Österreich 54 Prozent der Vermögen besitzen. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist demnach in Österreich am zweitgrößten in Europa. Ist das ein Problem?

Milanović: Eine sehr große Vermögensungleichheit ist ein Problem, weil damit Menschen, die ihren Reichtum vererbt bekommen, ein Leben ohne Arbeit ermöglicht wird, also ein Leben, ohne produktiv zu sein. Und reiche Menschen sind eher in der Lage, ihre Interessen politisch durchzusetzen, weil sie mit ihrem Geld politische Kandidaten fördern können. Allerdings ist die Messung von Vermögen kompliziert, und Ländervergleiche dieser Art sind schwierig.
STANDARD: Weshalb schwierig?
Milanović: Weil es immer länderspezifische Faktoren gibt, die dabei zu wenig berücksichtigt werden. In wohlhabenden Industrienationen verfügt ein Drittel der Bevölkerung über ein negatives Nettovermögen, weil es sich den LebensStandard über Kredite finanziert. Die Schulden dieser Gruppe übersteigen ihr Vermögen. Sie kaufen sich ein Haus mithilfe der Bank und belasten ihre Kreditkarten, vor allem jüngere Menschen tun das. In den größten Teilen der Welt funktioniert sowas nicht. In Indien gibt ihnen kein Mensch einen Kredit, der ihre Vermögenswerte übersteigt. Das macht Vergleiche schwierig. Dann gibt das Problem der Pensionen. In Ländern, in denen der Staat vorschreibt, dass Menschen einen Teil ihres Einkommens für die Pensionsvorsorge selbst investieren müssen, ist das private Vermögen höher als in Ländern mit einem staatlichen Umlagesystem. Aber in der Realität ist das Einkommen, das im Pensionsfall generiert wird, im Prinzip identisch.
STANDARD: Was folgt daraus?
Milanović: Es ist viel einfacher, über Ungleichheit in der Einkommensverteilung zu sprechen. Da ist die Sache klar: Ich kann feststellen, was jemand verdient, in Form von Arbeit oder Kapital. Da zeigt sich dann, dass Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern ein ziemlich egalitäres Land ist. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Probleme mit Ungleichheit in Österreich gibt, dass nicht einige Manager um ein Vielfaches mehr verdienen als ihre Arbeitnehmer. Aber die Einkommensungleichheit ist in vielen europäischen Ländern beträchtlich höher, ganz zu schweigen von den USA oder Lateinamerika.
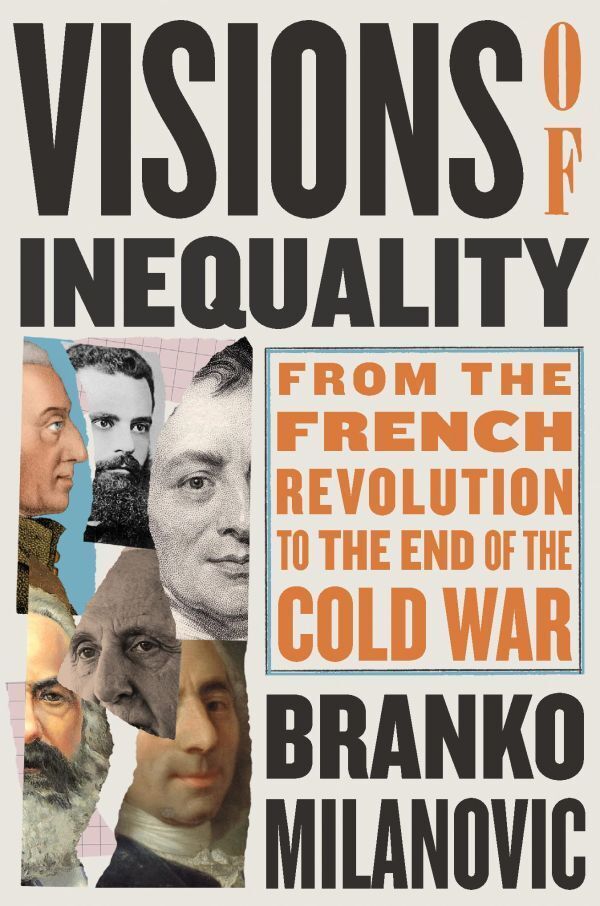
STANDARD: Sie haben schon vor Jahren argumentiert, dass die Einkommensunterschiede zwischen reichen und armen Ländern abnehmen. Stimmt der Befund noch?
Milanović:Die globale Ungleichheit ist in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen, weil etliche Länder, die früher extrem arm waren, schnell gewachsen sind und sich hier eine Mittelklasse herausgebildet hat. Das war insbesondere in China der Fall, aber auch in anderen Ländern Asiens wie Vietnam, Thailand, Indien, Indonesien. Inzwischen ist ein Punkt erreicht, an dem China so wohlhabend geworden ist, dass es nicht mehr zum Rückgang der weltweiten Ungleichheit beiträgt. Die Kluft könnte wieder wachsen.
STANDARD: Chinas Reichtum macht die Welt jetzt also ungleicher?
Milanović:Das mittlere Einkommen in China liegt heute über dem globalen Medianwert. Wenn China noch wohlhabender wird, ist das ein neutraler Faktor oder es trägt sogar leicht positiv zur Ungleichheit bei. Wenn es also um die globale Armutsbekämpfung und die Verringerung der Ungleichheit geht, sollten wir uns von China abwenden, auf das wir uns so lange konzentriert haben, und uns Indien sowie den großen afrikanischen Ländern wie Nigeria, Sudan, Kongo, Ägypten, Äthiopien zuwenden. Die Reduktion der globalen Ungleichheit wird sich fortsetzen, wenn es diesen Ländern gelingt, wirtschaftlich mit Raten zwischen fünf bis acht Prozent pro Jahr zu wachsen. So hoch waren die Wachstumsraten in Afrika in der Vergangenheit allerdings nie. Das sollte auch Europa sorgen.
STANDARD: Warum?
Milanović: Die physische Distanz zwischen Europa und Afrika ist gering, und die kulturelle ist es auch: Die meisten Afrikaner sprechen eine der großen europäischen Sprachen. Dafür ist die Einkommenskluft riesig und war in der Geschichte vermutlich noch nie so groß wie heute. Zwischen dem Römischen Reich und Ägypten waren die Unterschiede zum Beispiel sehr gering. Zugleich schrumpft Europas Bevölkerung, während jene in Afrika wächst. Es ist also klar, dass die Migration aus Afrika in diesem Jahrhundert nach Europa sehr bedeutend sein wird. Für Europa ist es daher wichtig, dass Afrika hohe Wachstumsraten erzielt, damit die Menschen das Gefühl haben, dass sie dortbleiben wollen.
STANDARD: Angesichts des rechten Einschlags, mit dem heutzutage in Österreich über Migration diskutiert wird, wird das viele schockieren.
Milanović:Sie sollten auch schockiert sein. Was sich hier aufgetan hat, ist ein langfristiges Problem. Mich wundert manchmal, wie kurzfristig Europa agiert angesichts dieser Problemlage, etwa wenn man sich in Kriege und Konflikte einmischt, im Nahen Osten, in Libyen oder Gaza. Diese Konflikte erzeugen neue Migrationsströme. Europa hätte ein großes Eigeninteresse, alles zu unternehmen, um die Region politisch zu stabilisieren und die Lebensumstände erträglicher zu machen.

STANDARD:Hat die sich reduzierende Kluft zwischen Arm und Reich, global gesehen, bereits dafür gesorgt, dass selbst ärmere Länder in der Lage wären, extreme Armut zu beseitigen? Sogar in diesen Staaten sind ja inzwischen viele Ressourcen vorhanden, aber oft eben sehr ungleich verteilt.
Milanović: Wenn man das Medianeinkommen von Westeuropa, Nordamerika und Japan nimmt und dann mit dem Medianeinkommen aller anderen Länder außer China vergleicht, dann ist das Verhältnis 8:1. Die Menschen in reichen Ländern sind achtmal reicher (diese Rechnung ist um unterschiedliche Preisniveaus in den Ländern bereinigt, Anm.). Sogar die Leute an der Spitze der Einkommensverteilung in Tansania sind also ärmer als die ärmsten Leute in einem europäischen Land. Die globale Ungleichheit ist also gesunken, das bedeutet aber gerade nicht, dass die Kluft nicht weiterhin extrem ist. Die Antwort auf die Frage ist also Nein.
STANDARD: Lässt sich sagen, wovon es im globalen Maßstab abhängt, wie erfolgreich jemand ist, ob man also viel oder wenig verdient? Welche Rolle spielt Fleiß?
Milanović: Wer in Österreich geboren wird, gehört im globalen Vergleich immer zu den 25 Prozent der reichsten Menschen, ganz gleich, wie viel er oder sie konkret verdient. Zwischen reichen und ärmeren Österreichern gibt es Unterschiede, aber jeder fällt irgendwo in diese Spitzengruppe. Jemand, der in Tansania geboren wird, gehört dagegen zu den 20 oder 25 Prozent der ärmsten Menschen. Wie hoch Ihr Einkommen ist, hängt also zu 50 bis 60 Prozent davon ab, wo Sie leben, welche Staatsbürgerschaft Sie haben beziehungsweise wo Sie geboren wurden.
STANDARD: Was sind die anderen Faktoren?
Milanović: Dann kommen noch 20 bis 30 Prozent dazu, die vom Vermögen des Elternhauses abhängen. Das muss nicht unbedingt eine Erbschaft sein, hier wirken sich die Schulwahl und soziale Beziehungen aus. Der Rest, 20 bis 30 Prozent unseres Einkommens, ist global gesehen jener Teil, zu dem wir selbst einen Beitrag leisten, durch Arbeit oder Fleiß.
STANDARD: Ernüchternd für den Kapitalismus. Hier lautet das Mantra: Aufstieg via Arbeit.
Milanović: Ich weiß nicht, ob es für den Kapitalismus ernüchternd ist. Das ist es für Menschen mitunter. Diese Unterschiede sind der Grund, warum sie migrieren wollen: Selbst jemand, der zu den zehn Prozent der wohlhabendsten Menschen in Uganda oder Tansania gehört, ist besser dran, wenn er nach Österreich kommt. Migration kann dazu führen, dass die Ungleichheit innerhalb eines Landes steigt. Global gesehen gibt es keinen Zweifel, dass durch Migration die Ungleichheit sinkt. (András Szigetvari, 27.1.2024)
