Es gibt da diese Legende, wie es dazu kam, dass Paul McCartney 1964 einen der erfolgreichsten Popsongs aller Zeit schrieb. Offenbar hörte er, als er eines Morgens noch im Bett mümmelte, eine Melodie in seinem Ohr. McCartney setzte sich ans Klavier und komponierte wie aus dem Nichts den Welthit Yesterday.
Es scheint wie ein magischer Prozess: Dieser "Flow", bei dem ein guter Gedanke nach dem anderen durch den Kopf zieht, bis sie plötzlich einfach von selbst da ist, die eine zündende, brillante Idee. Kreative machen sich diesen Flow zunutze, auch Forscherinnen und Forscher. Wo sie mit vorhandenen Informationen bei Problemlösungen nicht vom Fleck kommen, hilft ihnen die Kreativität. Aber in Wahrheit kennt ihn jeder: diesen beglückenden Zustand, in dem wir in aller Leichtigkeit Neues schöpfen. Manchmal gelangen wir von ganz allein dort hin, manchmal müssen wir ihm etwas auf die Sprünge helfen.
Weniger Handy, mehr Langeweile
Das ist ganz nicht einfach, denn die Kreativität hat viele Feinde: Da wäre die Bürokratie, die freie Phasen für Kreativität schier erdrückt, aber auch die vielen Reize, die sekündlich auf uns einprasseln. Die Welt ist geschäftig, laut, und überall sind Bildschirme, die uns ablenken. Wenn alle am Konferenztisch mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, kann wohl kaum ein kreativer Austausch stattfinden. Selbst an Bushaltestellen starren die meisten Menschen in ihre Handys. Pausen, in denen Gedanken frei schweben können, gönnen wir uns nicht mehr. Im Jahr 2022 hätte McCartney vielleicht eher die neuesten Storys auf Instagram gecheckt, statt dass ihm die Melodie von Yesterday eingefallen wäre.
Auch das Homeoffice ist gewissermaßen kreativitätsfeindlich: Wir treffen nicht mehr zufällig in der Kaffeeküche auf die Kollegin, mit der wir so gut Ideen spinnen können. Der Psychologieprofessor Keith Sawyer formuliert es ganz drastisch: "Telecommuting tötet Kreativität." Wie also können wir sie retten?

Antworten auf diese Frage soll ein Anruf bei Sarah Stein Greenberg geben. Die Innovationsexpertin leitet das Hasso Plattner Institute of Design, das "d.school" genannt wird und an der Stanford University angesiedelt ist. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dort, kreativ zu sein und innovative Lösungen zu entwickeln. In ihrem Buch Creative Acts for Curious People stellt Stein Greenberg auf 300 Seiten Strategien für jeden und jede vor.
Der innere Kritiker
Der erste Schritt in Richtung Ideenreichtum sei vergleichsweise simpel, sagt Stein Greenberg: Man müsse Tagträume zulassen. Es brauche Zeiten, in denen man die Gedanken einfach nur schweifen lässt, in denen man keinem fixen Plan folgt. "Wenn wir in unserer normalen Routine durch die Welt gehen, filtern wir einen großen Teil der Information. Das ist einerseits gut, denn so bleiben wir fokussiert." Andererseits sei dieses Filtern der Kreativität wenig zuträglich – denn man übersieht Details, die vielleicht einen guten Einfall zur Folge hätten. Oder einen Bedarf, den man vorher nicht registriert hat. "Vieles in unserer Welt wurde vor vielen Jahren designt. Also müssen wir hinausgehen mit dem Gedanken: All das müsste einmal neu erfunden werden." Es gilt also, banal gesagt, die Welt wieder mit anderen Augen zu sehen. So würden auch Designer an neue Projekte herangehen.
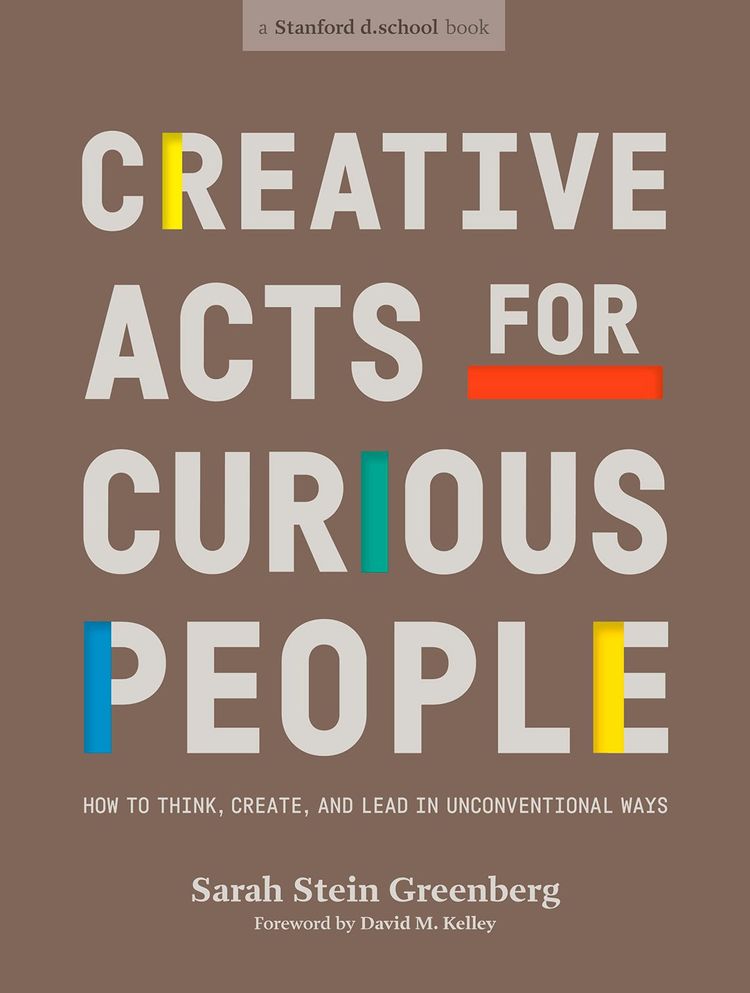
Hat man einen Einfall, dann meldet sich oft der nächste Verhinderer von Kreativität – nämlich der "innere Kritiker". Er sagt einem, dass das, woran man gerade denkt, keine gute Idee, sondern kompletter Blödsinn sei. "Wir sind oft sehr hart zu uns selbst. Wir wollen perfekt sein und gut dastehen, vor unserem Team, vor unseren Chefs", sagt Stein Greenberg. Der innere Kritiker verhindere oft schon im Voraus, dass eine Idee überhaupt weitergesponnnen werden kann.
Ist das überhaupt zu vermeiden? Ja, nämlich indem man den Prozess der Ideengenerierung strikt von der Bewertung der Ideen trennt, sagt die Expertin. Also: Zuerst wird gesammelt, erst später wird geurteilt. Ob die Ideen etwas taugen, ob sie gut sind oder auch nur gut genug, ist also zunächst einmal völlig gleichgültig.
Es gibt aber auch Situationen, in denen einen Selbstzweifel sogar antreiben können, sagt Stein Greenberg. Die Expertin spricht von einem Stadium des "productive struggle": "Man arbeitet hart, lernt viel dabei – aber ist gleichzeitig nervös und unsicher: Ist das gut genug?" Die Angst zu versagen treibe einen dann zu Höchstleistungen an. Man wachse über sich hinaus; sehr oft gelinge genau dann der Durchbruch. "Auch wenn sich diese Gefühle zunächst wie ein echter Kampf anfühlen können: Mit der Zeit lernt man, sie besser einzuschätzen und für sich zu nutzen," sagt Stein Greenberg.
Sich im Job immer nur zurückzulehnen und zu machen, was man immer schon gemacht hat, ist ergo eher ungünstig. "Übernimmt man immer nur Aufgaben, die sich leicht und gut anfühlen, dann wird einem nie etwas wirklich Innovatives einfallen", sagt die Expertin. "Innovation hängt immer auch mit einem gewissen Risiko zusammen."
Mut zu Fehlern
Aber es liegt nicht nur beim einzelnen Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiterin, kreative Prozesse in Gang zu setzen– sondern auch an ihren Führungskräften. Wenn ihnen Innovation ein Anliegen ist, müssen sie auch die Bedingungen dafür schaffen, sagt Stein Greenberg. Chefinnen und Chefs müssten ihrem Team Sicherheit geben. Das gelinge am besten, indem sie ihm die Angst nehmen, schlecht dazustehen. "Sie müssen sagen: Wir probieren gerade aus, wir urteilen jetzt nicht. Ich urteile nicht über eure Ideen, ihr urteilt auch nicht. Wir sammeln bloß." Gibt es weniger Vorgaben, kämen Menschen mit weit spannenderen Ideen. Stein Greenberg empfiehlt, einen Teil der Arbeitszeit speziell für Kreativität zu reservieren.
Denn kreative Arbeit funktioniert anders, und dauert mitunter auch etwas länger als Routinetätigkeiten. Dafür ist sie aber auch umso beglückender. (Lisa Breit, 9.4.2022)