
Bis zum gleißenden Horizont bestimmt eines das Bild: unglaubliche Mengen an Müll. Am Stadtrand von Dakar erstreckt sich die Mbeubeuss-Deponie über ein Areal von rund 170 Hektar. Das Gebiet hat etwa die dreifache Größe des Wiener Augartens. Der Tiergarten Schönbrunn würde zehnmal auf der Fläche Platz finden.
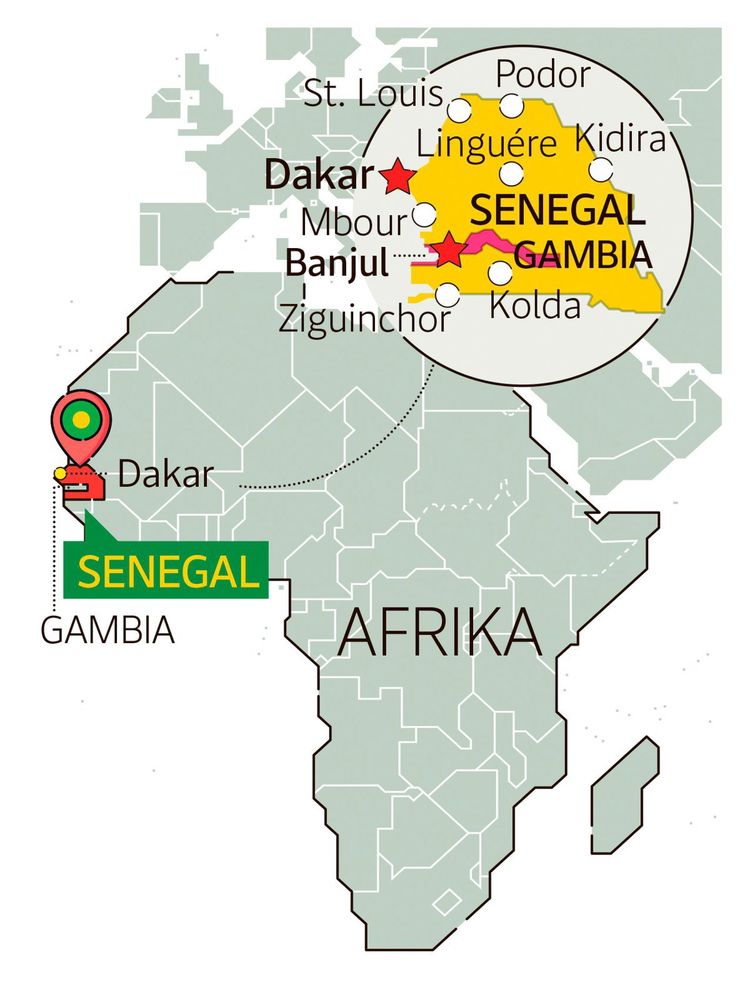
Mit dieser Ausdehnung gilt die Deponie als größte Müllhalde Westafrikas. Ununterbrochen passieren Müllwagen die Einfahrt, um den Abfall der senegalesischen Hauptstadt abzuladen. Er stammt von Haushalten, Unternehmen und der Industrie – 3500 Tonnen pro Tag.
Fünf Minuten dauert die Fahrt durch die Landschaft aus Müll, vorbei an Plastik, Schutt, Fetzen, alter Kleidung und Undefinierbarem. Es geht auf ein gewaltiges Plateau zu, hinein in eine apokalyptische Szenerie: Umsegelt von kreischenden Möwen drängen sich dutzende Menschen vermummt und gebückt um die eben erst abgeladene Charge eines Müllwagens. Mehr als 4000 Männer, Frauen und Kinder stöbern als inoffizielle Arbeitskräfte nach veräußerbaren Materialien.

Sammeln unter Lebensgefahr
Einer von ihnen ist der 18-jährige Lamin. Seit er neun Jahre alt war, durchsucht er die Fuhren von Müllfahrzeugen nach Rohstoffen wie PET-Plastik und Metall. Bis zu fünf Euro verdiene er am Tag. Ein stolzes Einkommen, aber keineswegs geschenkt. "Die Arbeit ist anstrengend und hart, ich fange um fünf Uhr früh an und gehe um fünf Uhr am Abend", erzählt er. Zu den Arbeitsbedingungen gehören sengende Hitze und bestialischer Gestank. Neben der körperlichen Anstrengung fordert auch die toxische Umgebung ihren Tribut.

2021 untersuchte ein Forschungsteam den Grad der Schwermetallbelastung bei Erwachsenen, die nahe der Mbeubeuss-Deponie wohnen. Die analysierten Biomarker deuten auf ein hohes Risiko künftig auftretender schwerer Nierenschäden bei allen Probanden hin. Eine andere Untersuchung stellte bereits davor erhöhte Bleiwerte in Blut- und Urinproben von Kindern fest, die in der Nähe des Areals leben. Zu den Gesundheitsrisiken, die in Zusammenhang mit der Arbeit auf oder dem Leben an Deponien stehen, zählen etliche Krebs- und Atemwegserkrankungen sowie ein erhöhtes Risiko für angeborene Fehlbildungen.
Unfälle und Krankheitsausbrüche
Die Organisation International Solide Waste Association spricht überdies wiederholt von mehreren Hundert Menschen, die jedes Jahr bei Unglücken oder Krankheitsausbrüchen auf Deponien ums Leben kommen. Von gefährlichen Zwischenfällen können auch die senegalesischen Sammler berichten. Unfälle passieren hier immer wieder. "Ich bin in einem Müllauto eingeklemmt worden und habe mir dabei die Hüfte gebrochen", erzählt Mame.

Unterstützt von seiner Familie kam er wieder auf die Beine. Da er in der Metallverarbeitung keine Stelle mehr fand, kehrte er auf die Deponie zurück. Hauptsächlich sind es arbeitslose Menschen oder solche ohne Ausbildung, Witwen und geschiedene Frauen, die hier die Chance auf ein Einkommen nutzen.
"Jedes Stück Plastik ist wertvoll", sagt Mame. Es wird von zwei chinesischen Unternehmen aufgekauft, aufbereitet und exportiert. Ein wenig entfernt hämmert ein junger Mann Metallstangen aus Betonteilen. "Metall bringt das meiste Geld", erklärt Mame. Es wird von zwei in Dakar ansässigen Unternehmen abgenommen.
Vergiftete Umwelt
Was sich nicht mehr verkaufen lässt, verlässt die Deponie nicht mehr und entfaltet hier seine toxischen Folgewirkungen. Sickerwasser nichtabgedichteter Müllhalden kann Böden und Grundwasser auf Jahrzehnte mit Schwermetallen wie Blei, Kadmium und Quecksilber, mit Chemikalien und anderen Schadstoffen kontaminieren und nahegelegene Ökosysteme schwer schädigen.

Nitrat und Phosphat können in Gewässern gewaltige Algenblüten auslösen und sie in tote Zonen verwandeln. Mit diesem Wissen beäugt man die verdächtig schwarzen Lacken überall auf dem Gelände noch skeptischer. Direkt an das Areal grenzen zwei Lagunen, unweit wachsen Mangrovenbestände, die einen unentbehrlichen Schutzschild gegen die zunehmenden Sturmfluten bilden.
Lokale Quellen globaler Dimension
So vielfältig die negativen Auswirkungen sich lokal ausnehmen, hinterlassen Deponien nicht nur vor Ort Spuren. Müllhalden mit einer Ausdehnung wie die Mbeubeuss-Deponie können mehrere 10.000 Tonnen Methan emittieren und die globale Erwärmung damit bedeutend vorantreiben.
"Elf Prozent der weltweiten Methanemissionen gehen auf Mülldeponien zurück", sagt Harald Rieder vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Boku Wien. Diese gewaltigen Mengen des Treibhausgases fallen besonders ins Gewicht, da Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren 25-mal so klimaaktiv ist wie CO2. Lezteres entsteht auf Müllhalden ebenso. Im Sinne der Klimaziele müssten diese Quellen gezielt ins Auge gefasst werden.

Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass gewisse Zerfallsprozesse im Untergrund erst nach fünf bis sieben Jahren ihre intensivste Emissionsphase erreichen. So heizen Deponien der Atmosphäre selbst dann noch ein, wenn sie stillgelegt und zugeschüttet wurden.
Widerstand gegen Schließung
Das soll auch auf der Mbeubeuss-Deponie geschehen. "In fünf Jahren ist hier alles grün und sauber," ist der Deponiemanager überzeugt. Auf dem Areal soll, finanziert von der Weltbank, eine automatisierte Sortierfabrik entstehen. Hunderte Menschen werden dadurch ihre Einkommensquelle verlieren. Proteste dagegen fanden bereits statt.
Offiziell heißt es, dass die Müllsammler monetär kompensiert werden sollen. "Für 200.000 Franc würde ich weggehen", sagt Lamin. Das entspricht gut 300 Euro. Insgeheim hoffe er aber auf einen Job in der Sortieranlage wie viele andere Sammlerinnen und Sammler. (Marlene Erhart aus Dakar, 26.2.2023)