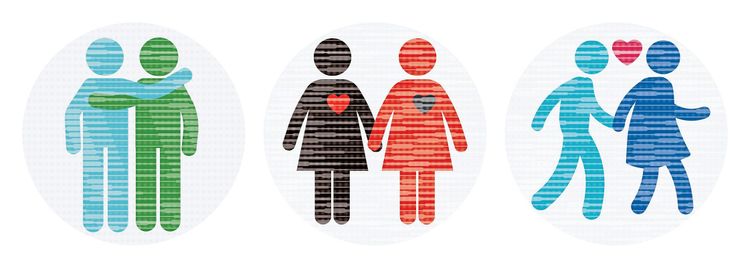
In einer Frage waren alle Koalitionen ein Herz und eine Seele: Frisch gebackene Regierungspartner sprechen künftige Postenbesetzungen ab.
Kollektives Schulterzucken: So lässt sich der erste Reflex des Establishments auf die publik gewordenen Sideletter zu den Koalitionsverträgen der ÖVP mit FPÖ und Grünen zusammenfassen. Sie verstünden die Aufregung nicht, sagten nicht nur Regierungsvertreter, sondern auch etliche Ex-Politiker. Was da geschah, sei sinnvolle, eingelebte Praxis.
Die geheim gehaltenen Papiere enthalten Absprachen über innerkoalitionäre Regeln, heikle politische Fragen und vor allem Personal im staatsnahen Bereich. Sowohl mit FPÖ als auch Grünen hat die türkise Kanzlerpartei vereinbart, wo welche Farbe zum Zug kommt.
Die Macht
Alles selbstverständlich? Zum Teil lässt sich da schwer widersprechen. Tatsächlich nimmt sich ein Ministerium nichts Unerhörtes heraus, wenn es Eigentümervertreter in die Aufsichtsräte der Staatsbetriebe entsendet. Da stellt sich allenfalls die Frage, ob das ausgewählte Personal auch kompetent ist.

Dem gegenüber stehen Beispiele, wo Regierende ihre Kompetenz überschreiten – etwa indem sie Vorstandsposten auspackeln, die der Aufsichtsrat zu besetzen hätte. Ein derartiger Verdachtsfall – der Sprung Thomas Schmids an die Spitze der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag – bringt derzeit die Kanzlerpartei ins Wanken.
Am kompliziertesten sind aber die Fälle dazwischen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) etwa ist unabhängig, die Richterschaft darf sich nicht von politischen Erwägungen leiten lassen. Eine Ausschreibung soll garantieren, dass die Besten zum Zug kommen. Doch am Ende muss irgendjemand die Auswahl treffen. In einer Demokratie landet man da bei den gewählten Vertreterinnen und Vertretern: Regierung, Nationalrat, Bundesrat.
Der Missbrauch
Dieses System lässt sich missbrauchen – in unterschiedlicher Intensität. "Eine demokratiepolitische Sauerei" nennt Verfassungsrechtler Heinz Mayer den Umstand, dass ÖVP und FPÖ vorab konkrete Namen für künftige VfGH-Besetzungen festgeschrieben hatten. Die Hearings, die bei den formell von Nationalrat und Bundesrat gewählten Kandidaten stattfinden, seien damit für die Katz’: "Da wird die Öffentlichkeit belogen."

Türkis-Grün war weniger dreist, man legte sich nur auf das Nominierungsrecht fest. Theoretisch könnte eine Partei in so einem Fall die Ausschreibung abwarten, um dann die am besten geeignete Person auszuwählen. In der Praxis pfeifen die Spatzen aber oft von den Dächern, wer das Rennen macht. Als "Farce" bezeichnete die Opposition 2018 ein Hearing im Parlament mit 40 Kandidatinnen und Kandidaten, vor dem sie die Auserkorenen schon zu kennen glaubte. Die Prognosen trafen in dem Fall ins Blaue.
Parteinähe schließe Fähigkeiten nicht aus, wenden Politiker gerne ein und versichern: Entscheidendes Kriterium sei die Kompetenz. Doch eine Studie von Laurenz Ennser-Jedenastik schürt Zweifel. Von 1995 bis 2010 wurden 1242 Spitzenposten in Staatsunternehmen besetzt, davon entfielen laut Berechnung des Politologen fast 60 Prozent auf Personen, die einer Partei zumindest nahestanden.
Egal, ob Rot, Schwarz oder Blau: Kaum war eine Partei in der Regierung, stiegen die Karrierechancen der eigenen Klientel sprunghaft. Eine anknüpfende Recherche der Plattform Addendum zeigte, dass sich daran bis dato nichts Wesentliches geändert hat.

Dass in der Mehrheit der Besetzungen zufällig jener Parteikandidat der qualifizierteste ist, sei nicht plausibel, folgert Ennser-Jedenastik und sieht ein bedrückendes Sittenbild. Ginge es lediglich um Staatsbetriebe, könnte man beide Augen zudrücken. Aber das Muster der Patronage ziehe sich von der Polizei bis zur Justiz durch etliche Bereiche: "Selbst wenn dies nur für 20 Prozent der Fälle gilt, wäre das problematisch genug."
Die Maßnahmen
Politiker von etwas abzuhalten, das sie dank ihrer Macht tun können und das in ihrem Interesse liegt, sei eine schwierige Aufgabe, sagt der Politologe. Ihm selbst fielen nur "zweitbeste Lösungen" ein. Der Stiftungsrat im ORF sei zu entpolitisieren, heißt es etwa.
Doch auch hier zeigt sich das Dilemma: Irgendwer muss das Gremium, das die Chefetage des Staatsfunks bestimmt, besetzen. Das Gesetz sollte zumindest so gebaut sein, dass die größere Regierungspartei keine solche Übermacht wie jetzt genießt, empfiehlt Ennser-Jedenastik: "Dann gibt es ein Gleichgewicht des Schreckens."
In Fällen wie in jenem des VfGH könnte eine Vorauswahl stattfinden, sagt Mayer: Institutionen wie Richtervereinigung und Rechtsanwaltskammer sollten den Pool auf die Kompetentesten eingrenzen, erst dann dürfe die Politik entscheiden. Allerdings gibt es gegen solch ein Modell auch Einwände. Für die Bindung an die politischen Vertretungen spricht, dass ein Richtergremium möglichst alle Weltanschauungen repräsentieren soll.
Ex-Rechnungshofchef Franz Fiedler, Ehrenpräsident von Transparency International Austria, plädiert für Verlagerungen von der Regierung zum Nationalrat – etwa bei der Kür des Mitglieds im Europäischen Gerichtshof. Dies sorge – siehe Rechnungshofpräsidenten – zumindest für mehr Öffentlichkeit. Die Wahl seiner Nachnachfolgerin Margit Kraker 2016 stand zwar auch unter Verdacht politischen Kuhhandels. Doch vielleicht hat gerade diese Debatte Kraker angestachelt, nun betont unabhängig zu agieren.
Die Moral
Grundsätzlich hält Fiedler aber nicht viel von neuen Gesetzen. Alle Versuche hätten wenig gefruchtet, um die seit 1945 währende Praxis auszuhebeln. Die Parteien suchten heute zwar weniger unfähige Leute aus als in den 1950ern, doch wer gar keinen politischen Rückhalt genieße, habe oft keine Chance, sagt er: "Es braucht ein moralisches Erwachen."

Wie stark Institutionen Unabhängigkeit wahren, liegt offenbar an mehr als an den Regeln. Trotz des Bestellmodus genießt der VfGH einen weitgehend untadeligen Ruf. Sozialdemokraten argwöhnen zwar, dass eine rechtskonservative Mehrheit im Gerichtshof den türkis-blauen Umbau der Sozialversicherung entgegen der bisherigen Judikatur durchgewinkt habe. Doch das gekippte Kopftuchverbot und die liberalisierte Sterbehilfe gegen den Willen der ÖVP sind Gegenbeispiele.
Auch die Höchstrichter auf türkisem Ticket sollen die Nase gerümpft haben, als die ÖVP 2018 ihren Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter ohne lange Cool-down-Phase in das Höchstgericht hievte. Nachdem sein Name in einem verfänglichen Chatprotokoll aufgetaucht war, trat er bereits 2021 wieder zurück – wohl auch wegen des Drucks aus dem VfGH.
Als von Unsitten geprägtes Gegenbeispiel nennt Ennser-Jedenastik den Stiftungsrat. Dass die Zustimmung der Parteivertrauten zu einem ORF-Chef mitunter offenbar an Personalzusagen bis auf die unteren Ebenen geknüpft ist, funktioniere nur, "weil darüber niemand spricht". Werden diese Deals publik, würden manche Beteiligten vor dem Makel zurückschrecken.
Demnach könnte die Veröffentlichung der Absprachen Wirkung zeigen. Bundeskanzler und Vizekanzler haben die Alles-ganz-normal-Erzählung mittlerweile über Bord geworfen. Beide versprechen: Geheime Sideletter werde es nicht mehr geben. (Gerald John, 5.2.2022)