
Im Tierreich wurde bisher ein eigentümliches Phänomen beobachtet. Je größer ein Organismus ist, also je mehr Zellen er besitzt, desto höher müsste die Wahrscheinlichkeit sein, dass eine dieser Zellen zu einer Krebszelle mutiert. Allerdings unterscheiden sich die Krebsraten von sehr großen Säugetieren wie Elefanten und Walen verhältnismäßig wenig von jenen kleinerer Arten wie Mäusen oder Forellen. Dies wird als "Peto's paradox" bezeichnet – benannt nach dem britischen Wissenschafter Sir Richard Peto, der sich mit Statistik und Epidemiologie befasste.
Das Thema wird kontrovers diskutiert, es gibt mehrere Erklärungsversuche. Beispielsweise könnten die Reparaturmechanismen bei großen Tieren besser funktionieren oder bestimmte hilfreiche Gene häufiger vorkommen. Neue Daten, die auch das Peto-Paradoxon miterklären könnten, liefert eine Wiener Gruppe vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Sie analysierte über zehn Jahre hinweg Proben von 580 Tierarten, um ihr Epigenom zu vergleichen – also Veränderungen rund um die DNA.
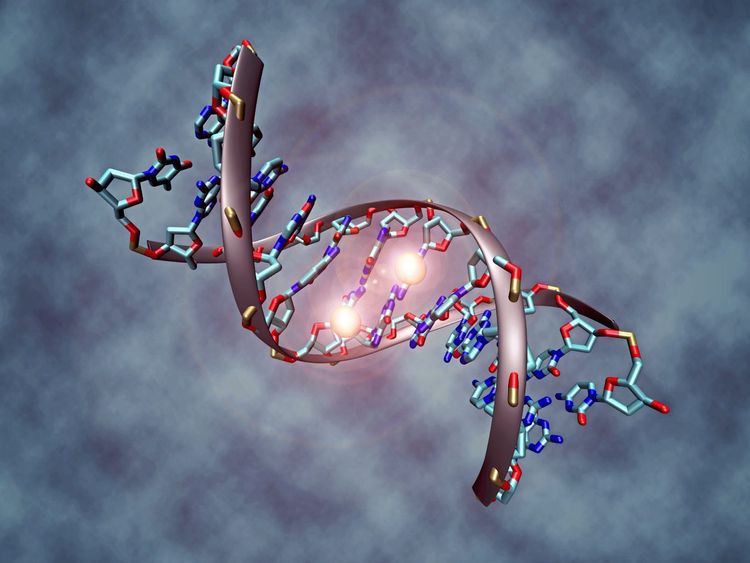
Gewebeproben vom Naschmarkt
Die umfangreiche Kartierung, bei der die Erforschung des Paradoxons eigentlich nicht das Kernziel war, wurde im renommierten Fachjournal "Nature Communications" veröffentlicht. Das Forschungsteam um die Erstautorinnen Johanna Klughammer und Daria Romanovskaia konzentrierte sich auf eine bestimmte Art der epigenetischen Veränderung, die bisherigen Analysen zufolge eine besonders wichtige Rolle einnimmt: die DNA-Methylierung. Dabei wird ein bestimmter chemischer Baustein an das Erbgut angelagert, sodass es an dieser Stelle nicht mehr abgelesen werden kann, also gewisse Gene inaktiv sind.
Knapp 2.500 Proben untersuchte die Forschungsgruppe auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin – aus verschiedenen Organgeweben, darunter Herz, Leber, Lunge und Hirn. Die Gewebeproben stammten großteils von der Wildtierpathologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmed) und dem Ocean Genome Legacy Center im US-amerikanischen Boston. Manche kamen zudem vom Wiener Naschmarkt: Dort kauften Teammitglieder Speisefische und Muscheln. Kolleginnen und Kollegen wurden außerdem um Proben von Kamelen und Axolotl gebeten.

Von Seestern bis Mensch, von Elefant bis Oktopus
Das Ergebnis: Das epigenetische Muster der Tiere ist überraschend ähnlich – vom Seestern bis zum Menschen. Das lässt darauf schließen, dass sich die genetischen "Zugangskontrollen", welche Gene abgelesen oder ignoriert werden, evolutionär seit 500 Millionen Jahren kaum veränderten. "Wir konnten zum Beispiel die Verteilung der DNA-Methylierungen im Erbgut des Elefanten mit einem Modell vorhersagen, das wir für den Oktopus erstellt hatten", sagt Romanovskaia.

Auch Unterschiede zeigten sich, wie Forschungsgruppenleiter Christoph Bock erklärt: "Der genetische Code der Epigenetik ist in Wirbeltieren klarer und verbindlicher als in Wirbellosen, obwohl die zugrundeliegenden Muster ähnlich sind." Als Reptilien, Vögel und Säugetiere entstanden, wurde die Verbindung zur genetischen Komponente der DNA-Methylierung stärker. "Es scheint, als seien komplexe Tiere, der Mensch eingeschlossen, besonders auf den epigenetischen Schutz des Genoms durch DNA-Methylierung angewiesen."
Soft- und Hardware im Zellkern
Bemerkenswert ist, dass die umfangreiche Studie die bisher umfassendste Analyse der Epigenetik in evolutionärem Kontext sein dürfte. Dabei wurde es durch neue Methoden auch möglich, das Zusammenspiel von Genetik und Epigenetik "in Tierarten zu erforschen, die für epigenetische Analysen bisher kaum zugänglich waren", sagt Klughammer, die in der Zwischenzeit eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München angetreten hat.

Das Ein- und Ausschalten von Genen durch DNA-Methylierung kann man – wie auch in der Aussendung des CeMM geschehen – mit einem Computer vergleichen: "Die epigenetische 'Software' schützt unsere genetische 'Hardware' davor, in den falschen Zellen aktiviert zu werden." So können sich Zellen spezifischen Aufgaben widmen, erklärt Bock: "DNA-Methylierung stattet die Zellen mit einem epigenetischen Gedächtnis aus und sorgt dafür, dass eine Leberzelle immer eine Leberzelle bleibt und eine Herzzelle immer eine Herzzelle, obwohl alle Zellen in unserem Körper mit den gleichen Genen ausgestattet sind."
Große Tiere, mehr Schutz vor Krebs?
Auch Wachstumsgene, die Krebs auslösen könnten, wenn sie zur falschen Zeit aktiviert werden, befinden sich auf diese Weise in einem Ruhezustand. DNA-Methylierung schützt viele Tierarten also mitunter vor Krebs, wie die Studie annehmen lässt.
In Sachen Peto-Paradoxon ergibt sich dabei: Je höher das theoretische Krebsrisiko, desto höher war der Grad der DNA-Methylierung. Besonders deutlich zeigte sich diese Korrelation in der Studie übrigens bei Vögeln: "Die meisten Vögel haben ein geringes Krebsrisiko, sogar große Vögel mit langer Lebenszeit wie Adler und Pinguine", heißt es in der Aussendung. "Die höheren DNA-Methylierungsniveaus in großen, langlebigen Vögeln könnten also helfen, sie vor Krebs zu schützen." Damit gibt es eine weitere Erklärungsmöglichkeit für das ungewöhnliche Phänomen, die der Fachwelt zur Diskussion gestellt wird. (sic, 20.1.2023)